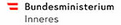Elfriede Gerstl, geb. 1932 in Wien. Stammte aus einer liberalen jüdischen Familie. Um der Deportation zu entgehen, lebte sie als Kind gemeinsam mit ihrer Mutter als "U-Boot" versteckt in Wien (Sommer 1942 bis zur Befreiung 1945).
Nach 1945 Maturaschule und Studium. Mitte der 1950er Jahre erste Veröffentlichungen. Zahlreiche Auszeichnungen für ihr literarisches Schaffen.
Verstorben 2009.
Ich würde sagen, dass ich aus einer liberalen jüdischen Familie stamme. Der Bekanntenkreis bestand aus Juden und Nichtjuden, ich kann mich nicht erinnern, dass das ein Diskussionsthema war. Wirklich religiös war wahrscheinlich nur meine Großmutter. Meine Eltern, die eben schon beide in Wien geboren sind, sind eigentlich nur zu den Feiertagen in den Tempel gegangen und haben auch die Feiertage im Haus gefeiert. [...]
Meine Eltern haben sich lange vor 1938 scheiden lassen, und ich bin mit meiner Mutter, meiner Tante und meiner Großmutter aufgewachsen. Die drei Frauen, die sicher etwas verunsichert und unentschlossen waren, haben halt die Situation falsch eingeschätzt und bagatellisiert und haben gedacht, es wird schon nicht so schlimm kommen, wir haben ja nichts gemacht, was wird man uns schon tun oder nehmen? Und dann hat es die ersten Auswirkungen gegeben, Freunde gingen in die Emigration, es ist mit Bekannten in Amerika und England korrespondiert worden. Und keiner konnte sich entscheiden, wohin man gehen soll. Das Land zu verlassen wäre wahrscheinlich finanziell möglich gewesen, aber es waren psychologische Barrikaden schuld. Mein Vater emigrierte, aber es war überhaupt keine Rede davon, dass ich mitgehe. [...]
Wir sind aus unserer Wohnung, die in der Neulinggasse war, ausgesiedelt worden, mussten die meisten Möbel zurücklassen und sind eigentlich nur mit wenigen Sachen und ganz überraschend aus der Wohnung geholt worden. Wir mussten schnell in wenigen Stunden alles zusammenpacken, was wir mitnehmen wollten, und sind dann in eine viel kleinere Substandardwohnung gebracht worden: in die Rembrandtstraße 28, im zweiten Bezirk. Dort haben wir noch einige Jahre zugebracht. Nach dem Tod meiner Großmutter hat es überhaupt keine Fluchtmöglichkeiten mehr gegeben, mehrmals sind Gestapo-Beamte gekommen, die uns holen wollten, und meine Mutter hat sie immer wieder mit Tricks hingehalten, dass sie noch Unterlagen nachbringen wird usw. Sie hat auch eine Art "Ariernachweis" vorgelegt, der ohne Stempel war, glücklicherweise haben die das nicht bemerkt. Es ist unglaublich, dass es doch möglich war, denen Geschichten zu erzählen und sie hinzuhalten.
Das ist ein paarmal so gegangen, dann war aber unsere Abholung für den folgenden Tag geplant, und da sind wir spät nachts weg. Das muss im Sommer 1942 gewesen sein. Mit einem kleinen Köfferchen sind wir in das Haus, in dem wir früher gewohnt haben, und die Hausbesorgerin hat uns in einer nicht bewohnten, aber noch halb eingerichteten Wohnung untergebracht. Und zwar war das eine Atelierwohnung, wo die Nachbarn eben auch nicht da waren. Die Hausbesorgerin konnte einmal am Tag zu uns kommen und uns mit Lebensmitteln versorgen. Dort blieb ich mit meiner Mutter einige Zeit versteckt. Meine Tante ist nur fallweise gekommen, hat sozusagen Nachrichten von außen, eine Zeitung oder sonst was gebracht. Sie war durch ihren nichtjüdischen Mann geschützt. [...]
Mehrmals mussten wir das Quartier wechseln. Eine Gemüsehändlerin, bei der wir früher immer eingekauft haben, hat uns eine Zeitlang in der Ungargasse untergebracht. Und wie sie dann aber Angst bekommen hat, dass die Leute im Haus was bemerken - es war sehr gefährlich, es war ja wirklich sehr gefährlich, jemanden zu verstecken -, da haben wir im Augenblick keine andere Möglichkeit gesehen und sind spätabends in die frühere Wohnung in die Rembrandtstraße zurück. Irgendwie haben wir die Tür aufbekommen. Wir sind dann ein paar Tage wahrscheinlich unbemerkt im Haus gewesen, haben uns aber dann doch Nachbarn anvertraut, die uns versorgt haben. Und die größten Nazis, die in diesem Haus wohnten, waren glücklicherweise am Land, weil man dort eben mehr Lebensmittel auftreiben konnte. Das war unsere Rettung, weil die größten Nazis im Haus waren unsere direkten Nachbarn, die hätten uns sicher angezeigt.
Die anderen Leute, das waren alles, kann man sagen, Arbeiterfamilien, z. B. ein Briefträger und seine Familie. Also ich muss sagen, dass sich alle als sehr anständig und hilfsbereit erwiesen haben, dass sie uns versorgt und für uns eingekauft haben. Sicher zum Teil gegen Bezahlung, Schmuck und andere Wertgegenstände meiner Mutter, aber uns zu helfen war ja lebensgefährlich, das war ein großes Risiko. [...]
Es gab viele alltägliche Probleme: Kleidung - ich habe meistens Sachen angehabt, die mir entweder zu groß oder zu klein waren. Das größte Problem war, Schuhe zu bekommen, weil ich war ja ein Kind, und meine Füße sind schließlich gewachsen. Das war das größte Problem. Ich bin lange Zeit in viel zu kleinen Schuhen herumgegangen und hab davon einen Fersensporn bekommen, das war sehr schmerzhaft. Schließlich bin ich dazu übergegangen, die Fersen der Schuhe niederzutreten, nur um die Ferse frei zu haben, weil ich schon furchtbare Schmerzen gehabt habe. Ich hab immer zu enge Schuhe gehabt. Sonst kann man ja auch mal etwas zu Großes anziehen, aber bei den Schuhen ist das anders. [...]
Manchmal hätten wir schon ärztliche Hilfe gebraucht. Meiner Mutter sind so nach und nach die Zähne abgebrochen. Aber sie hat sich nicht getraut, einen Zahnarzt aufzusuchen. Nur einmal, als ich eine Kinderkrankheit hatte, kam unsere frühere Hausärztin. [...]
Für meine Mutter war es natürlich auch eine bedrückende Situation. Sie war total eingeengt, es war furchtbar und einengend. Ich glaube aber, dass es für ein Kind noch schlimmer ist. [...]
Wir sind ja faktisch die ganze Zeit im Bett gelegen. Man durfte keinen Lärm machen, man sollte sich nicht am Fenster zeigen. In der Wohnung, wo wir im dritten Bezirk unterm Dach versteckt waren, da hat man auch darauf achten müssen, wann man auf die Toilette geht, wann man Wasser in der Küche nehmen kann. Da hat uns die Hausmeisterin gesagt, zu welchen Zeiten die Leute weg und wann sie im Allgemeinen da sind. Tagsüber haben die gearbeitet, abends waren sie zu Hause. Da musste man erst recht leise sein. So konnten wir eigentlich hauptsächlich nur liegen, schauen oder lesen.
Im zweiten Bezirk dann, in unserer eigenen Wohnung sozusagen, da gab es eine andere Erschwernis, da war die Rollo unten, das heißt, man hat aus Papier, aus schwarzem Papier, eine sogenannte Verdunkelungsrollo gehabt. Wenn Leute verreist waren oder abends, musste diese heruntergelassen sein. Wir haben ja als weggebracht gegolten. So war die Rollo nur unten. Von dem Hinaufrollen und durch die Befestigung gab es an beiden Seiten Löcher im Papier. Und nur durch diese Löcher und die Spalten an den Seiten ist Licht gekommen. So konnte man nur dort in der Nähe lesen oder einen Blick hinauswerfen.
Das war bedrückend, das war entsetzlich. So eingezwängt zu sein, so wenig Bewegung machen zu dürfen, so wenig Kontakt haben zu können, überhaupt keinen Kontakt zu Gleichaltrigen. Ich hab mich ja vor Kindern fast gefürchtet. Ein Kind, das im Freien herumlaufen möchte, mit Spielkollegen - soll man das nicht bedrückend finden, wenn man in einem fast dunklen Zimmer sich ruhig verhalten muss, möglichst im Bett liegen soll. Soll man das nicht bedrückend finden? Das ist ja ein Wahnsinn! Das ist schon für einen Erwachsenen schlimm, in so einem Gefängnis zu sein, und viel, viel schlimmer ist das für ein Kind, das ja auch ein größeres Bewegungsbedürfnis hat, ein Kommunikationsbedürfnis. Es ist die Hölle.
Ich war von allem abgeschnitten: von möglichen Vorbildern; es war für mich unmöglich, mich im Freien zu bewegen, spazieren zu gehen, Sport zu treiben, was andere als selbstverständlich überhaupt nicht wahrnehmen, all das war mir verwehrt. Man kann schon von Gefängnissymptomen sprechen.




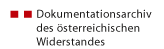







 English
English Termine
Termine Neues
Neues