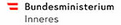Stefanie Coché: Psychiatrie und Gesellschaft
Dissertation, Universität zu Köln, 2014 (Abstract)
Diese Arbeit wurde mit dem Herbert-Steiner-Preis 2015 ausgezeichnet.
Die Dissertation befasst sich aus vergleichender Perspektive mit der Geschichte der Psychiatrie im Nationalsozialismus, der BRD und der DDR im Zeitraum von 1941 bis 1963. Über eine Kombination wissenschafts-, justiz- und alltagsgeschichtlicher Perspektiven leistet sie einen Beitrag zur deutschen Gesellschaftsgeschichte, der die Verhältnisse in beiden "totalitären" Diktaturen und der westdeutschen Nachkriegsdemokratie im Zusammenhang thematisiert. Dabei liegt die Annahme zugrunde, dass Inklusions- und Exklusionspraktiken wesentliche Instrumente zur Generierung gesellschaftlicher Normalität sind. Psychiatrische Anstalten eignen sich vor diesem Hintergrund in besonderem Maße als Untersuchungsobjekt, da sie Menschen, die auf unterschiedliche Weise den zeitspezifischen Normalitätserwartungen nicht entsprechen, von der "Gesellschaft" trennen. Auf diesen Trennungsprozess konzentriert sich das Erkenntnisinteresse. Im Mittelpunkt der Studie steht daher die Praxis der Einweisung in psychiatrische Anstalten, die als folgenreicher Prozess der Abgrenzung und der Definition gesellschaftlicher Normalitätsstandards ex negativo begriffen wird. Die Arbeit geht der Einweisungspraxis auf der Basis von 1424 Patientenakten aus sechs Anstalten, Regularien, Kostendiskussionen sowie psychiatrischen Lehrbüchern und Zeitschriften in vier Kapiteln nach.
Das Kapitel Staat und Psychiatrie beschäftigt sich vor allem mit zivilen Einweisungen. In der Kriegszeit liegt der Schwerpunkt auf dem Umgang mit erkrankten Menschen durch Angehörige und Ärzte vor dem Hintergrund der Krankenmorde sowie auf dem Umgang der Patientinnen und Patienten mit Überweisungen für stationäre Aufenthalte. Für die unmittelbare Nachkriegszeit wird nach Veränderungen auf mehreren Ebenen gefragt. Es werden der materielle Mangel und seine Auswirkungen auf die Führung der Krankengeschichten untersucht und es wird nach den Auswirkungen der "Zusammenbruchsgesellschaft" auf die Einweisungspraxis gefragt. Hier werden zerrüttete Familienverhältnisse der Vertriebenen ebenso thematisiert wie Fragen nach der Funktion der Gutachtertätigkeit. Es wird gezeigt, dass die Psychiatrie sich in ihrer Funktion hier vor allem nach den Erfordernissen richtete, die aus der Gesellschaft kamen. Anschließend wird untersucht, ob und wie sich Einweisungswege mit den Staatsgründungen veränderten. Weder die Alliierten noch einer der beiden deutschen Staaten hatten in den 1950er-Jahren großes Interesse an der Psychiatrie; die Anstalt an sich unterlag mit den Staatsgründungen keinen besonderen Neuerungen. Aber galt dies auch für die Wege der Einweisung und für die Funktion der Anstalt? Für wen die mit konstanten Kosten verbundenen stationären Plätze gedacht waren, wurde in BRD und DDR thematisiert und dies erlaubt Aussagen über die Verortung der Psychiatrie in den neugegründeten Staaten. Das Kapitel schließt mit einem diachronen Überblick zur Perspektive der Patientinnen und Patienten und der Frage danach, welche Position Patientinnen und Patienten im Einweisungsprozess einnahmen. Hier kann unterschieden werden zwischen Zwangseinweisungen und zivilen Einweisungen; inwiefern ist dies aber aussagekräftig, um sich der Position der Patientin oder des Patienten zu nähern? Hier zeigt sich bereits, dass Patientinnen und Patienten sich in einem Spannungsfeld von Freiwilligkeit und Zwang selbst bei zivilen Einweisungen befanden.
Dies führt zum Thema Zwangseinweisungen, dem das nächste Kapitel Gefahr und Sicherheit gewidmet ist. Zwangseinweisungen liefen in NS, DDR und BRD unterschiedlich ab. Auch bei Zwangseinweisungen muss gerade vor dem Hintergrund der Krankenmorde gefragt werden, wie Menschen zunächst in den Fokus von Polizei und Gesundheitsämtern kamen. Es stellt sich die Frage, inwiefern das familiäre und soziale Umfeld, aber auch medizinische Institutionen im Vorfeld der Aufnahme an der Entscheidung für Zwangseinweisungen beteiligt waren. Für die Kriegszeit werden drei Gruppen von Menschen untersucht, die regelmäßig Gegenstand von Zwangseinweisungen wurden: Zunächst werden Soldaten als Patienten thematisiert. Anschließend werden Patientenakten älterer Menschen analysiert und schließlich Einweisungen von Frauen im Zusammenhang mit Sexualität untersucht. Für die Nachkriegszeit stellt sich die Frage, wie in der BRD mit gesetzlichen Neuregelungen umgegangen wurde. Führte die richterliche Zwangseinweisung in der BRD zu einer veränderten Dynamik zwischen Patientinnen und Patienten, ihren Angehörigen und Ärzten? Ebenfalls ist angesichts des föderalen Systems der Bundesrepublik zu fragen, ob es regionale Unterschiede in der Praxis und der Reaktion auf die Neuregelungen gab. Für die DDR hingegen ist zu untersuchen, wie das Regelvakuum, das bis 1968 existierte, in der Praxis gefüllt wurde. Wurde weiterhin hauptsächlich polizeilich durch Gesundheitsämter eingewiesen, wie in der NS-Zeit, oder wurde hier ein neuer Modus Operandi gefunden? Die Tatsache, dass es ein so langanhaltendes Regelvakuum gab, und die Frage, wie es in der Praxis ausgefüllt wurde, werden auch vor der Folie der Forschungsperspektive auf die DDR als durchherrschte Gesellschaft/Diktatur der Grenzen beleuchtet. Denn es stellt sich die Frage, inwiefern der Staat in der Einweisungspraxis agierte, auf welchen Ebenen es überhaupt staatliche Vorgaben und staatliches Interesse gab, mit dem sich etwa Angehörige bei der Einweisung konfrontiert sahen.
Während in den Kapiteln III und IV oft nicht-medizinische Akteure im Fokus stehen, widmet sich Kapitel V Krankheit und Diagnostik vermehrt den Psychiatern sowie dem Verhältnis von Ärzten und medizinischen Laien. Zuerst geht es um das Selbstverständnis der Psychiater bei der Diagnostik und in der Einweisungssituation. Dies wird anhand von Diskussionen um Diagnoseklassifikationen im Allgemeinen und am Beispiel der Erkrankung Schizophrenie im Speziellen analysiert. Hierfür wird zum einen das fachliche Selbstverständnis in Abgrenzung zu der Schwesterdisziplin Neurologie herausgearbeitet. Zum anderen geht es um die Zirkulation von Praxiswissen zwischen lokalen Einrichtungen, nationalem Kontext und der Einbettung in die Ordnung des Kalten Krieges, um Traditionserhaltung und Mechanismen der Aneignung. Anschließend konzentriert sich das Kapitel auf die Vorstellungen von Krankheit und Gesundheit medizinischer Laien und auf die Position, die Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen gegenüber Ärzten einnahmen. In den beiden Kapiteln Staat und Psychiatrie und Gefahr und Sicherheit wird herausgearbeitet, dass sich die Einweisungsargumentationen in der Kriegszeit bedingt durch das Wissen um die Krankenmorde ebenso wie durch die Kriegsumstände in erster Linie um pragmatische Fragen drehten bzw. pragmatisch gerechtfertigt wurden. So waren in den Einweisungsbegründungen Gefahrenszenarien auf der einen Seite und auf der anderen Seite Überlegungen von Patientinnen und Patienten und ihren Familien zentral, die darum kreisten, wie (staatliche) Anstalten zu meiden wären. Deutlich zurück traten demgegenüber medizinische Aspekte, die in der Nachkriegszeit wieder wichtiger wurden. Auch in wissenschaftlichen Publikationen ging es um Diagnoseprobleme, die während der Kriegszeit keine vergleichbare Rolle gespielt hatten.
Ein Thema, das in allen drei Systemen sowohl bei Ärzten als auch bei medizinischen Laien in irgendeiner Weise präsent war, war die Arbeitsfähigkeit und der Arbeitswille der Eingewiesenen und manchmal auch ihrer Familien, dem im letzten Kapitel Arbeit und Leistung nachgegangen wird. Arbeit und Gesundheit werden in Inklusions- und Exklusionsargumentationen der Verwandten und der Patientinnen und Patienten untersucht sowie in Vorstellungen der Eingewiesenen von einem gesunden Selbst und in psychiatrischen Krankheitskonzeptionen in Theorie und Praxis. Es wird hinterfragt, inwiefern Vorstellungen von Arbeit und einem gesunden Selbst gender-, schicht- oder staatspezifisch waren. Definierten Männer ihre Gesundheit anders als Frauen, vor allem über Arbeitsfähigkeit? Ist die Beschreibung eines gesunden Selbst als eines arbeitsamen Selbst ein Grundparameter in Staaten, die sich als Arbeits- und Leistungsgesellschaft ansahen, wie es auf unterschiedliche Weise für NS, DDR und BRD der Fall war? Für die Seite der Psychiater wird untersucht, inwiefern ihre Einschätzungen und Erklärungsmodelle für Patientinnen und Patienten, die sich als "überarbeitet" ansahen, systemspezifisch waren. Zugleich stellt sich die Frage, ob den neuen theoretischen Ansätzen auch Veränderungen in der Praxis folgten.
Stefanie Coché, M. A., Historikerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität zu Köln
<< Herbert-Steiner-Preisträger*innen




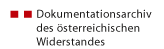





 English
English Termine
Termine Neues
Neues