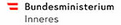Ester Tencer, geb. 1909 als Tochter eines Rabbiners in Galizien, 1914 Übersiedlung nach Wien, Buchhalterin. 1934-1938 illegale Betätigung für eine kommunistische Studentengruppe. Ende Jänner 1939 Belgien. Zugehörigkeit zur "Mädelgruppe" der Kommunistischen Partei, die versuchte, deutsche Soldaten im antinazistischen Sinn zu beeinflussen. März 1943 festgenommen, Jänner 1944 Überstellung in das Sammellager Malines, von dort nach Auschwitz. Ab Anfang 1945 Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück, von dort Mitte April 1945 vom Roten Kreuz nach Schweden evakuiert.
Rückkehr nach Wien. Ehrenamtliche Mitarbeiterin des DÖW.
Verstorben 1990.
Mein Elternhaus war ein sehr frommes Haus mit allen religiösen Sigmen. Mein Vater war Rabbiner, mein ältester Bruder später auch. Es war unseren Eltern sehr wichtig, uns lernen zu lassen. Sie wollten, dass alle Kinder in die Schule gehen und lernen. Und wir waren sechs Geschwister, ein Bruder, er war der Älteste, und fünf Mädchen. Wir sind alle hier in die normale Schule gegangen, daher hatten wir natürlich unter den Mitschülern viele nichtjüdische Freunde. [...]
Wir haben im 2. Bezirk in der Ausstellungsstraße gewohnt. In unserem Grätzel haben eigentlich nicht so viele Juden gewohnt. Daher hat es auch dort kaum koschere Geschäfte gegeben. Diese waren hauptsächlich in einem anderen Teil der Leopoldstadt: Im Werd, in der Leopoldsgasse, am Karmelitermarkt, da musste man extra hinfahren, um einzukaufen. Meine Mutter ging dorthin einkaufen, ich selbst bin eher selten hingekommen. In unserer Nähe gab es nur ein kleines Bethaus. [...]
Wir waren eigentlich zu Hause ziemlich abgeschlossen. Wir hatten vor unserem Haus zwei Vorgärten - es war ein Doppelhaus -, und da haben wir Kinder gespielt, und wir waren eigentlich sehr lang Kinder. Bei uns ist auch nie über Politik gesprochen worden, ich habe also das 27er und das 34er Jahr nicht ganz mitbekommen. Wir bekamen von den Eltern eine - sagen wir - soziale Basis, auf die meine Schwester und ich dann später aufbauen konnten, als wir zur Studentenbewegung gekommen sind und mit der politischen Arbeit begonnen haben. Bei unseren Freunden, mit denen wir im Garten oder in der Schule zusammen waren, gab es weder eine religiöse noch eine soziale Trennung, absolut nicht. Wir haben gemeinsam, Jungen und Mädchen, Fußball und weiß Gott was gespielt. Ich weiß nicht einmal, ob sie Juden oder Christen waren. Das könnte ich nicht einmal feststellen. Wir haben auch keinen Antisemitismus wahrgenommen, zumindest wir Mädchen nicht. In der Schule waren wir sehr gut, dadurch konnten wir natürlich den anderen helfen und haben einen wirklich guten Kontakt zu allen gehabt. Natürlich auch zu den Lehrern, Wenn man eine gute Schülerin ist, ist man irgendwie im Vorteil, und ich habe damals keinerlei Probleme gehabt - in der Kindheit nicht. Erst viel später, als mein Vater gestorben war und mein Bruder dann den Posten vom Vater übernommen hat. Er war noch nicht einmal achtzehn Jahre alt. Damals ist dieser Antisemitismus schon hervorgetreten. Wohl auch, weil er ein bisschen anders angezogen war, eben so, wie Rabbiner gehen. Wohl nicht mit Langkaftan, aber immerhin doch in Schwarz und mit Hut. Wir persönlich als Mädchen haben das nicht gespürt, aber bei meinem Bruder haben wir das schon bemerkt.
Bei der jüngsten Schwester, die im Gymnasium war, hat es dann Bemerkungen gegeben, mit denen man sie ein bisschen drücken wollte, obwohl sie wirklich eine ausgezeichnete Schülerin war. Da gab es eben Lehrer, die ziemlich antisemitisch waren. Und da weiß ich, dass meine Mutter einmal hingegangen ist und einen rechten Wirbel gemacht hat. Aber das war 1937, da war der Antisemitismus schon ziemlich weit verbreitet. [...]
Als ich schon in die Handelsschule ging, hatte ich immer lange bis in den Nachmittag hinein Unterricht. Bei den Juden beginnt schon Freitag abends der Sabbat. Im Winter ist das natürlich ziemlich zeitig. Ich hab' damals um drei oder vier Schule ausgehabt und musste immer laufen, damit ich zum Kerzenzünden [Beginn des Sabbats] zu meinem Bruder zurechtkomme. Die Mutter wollte immer, dass die Kinder beim Kerzenzünden dabei sind. Auf dem Heimweg sehe ich zwei "Gschroppen" [Kinder], die ohne Schuhe betteln gehen. Das war damals so üblich, dass Arme am Freitag von Geschäft zu Geschäft sind, und ich bin eben durch ein Geschäftsviertel gegangen. Und ich erinnere mich an die Worte der Eltern, die immer gesagt haben: "Wenn du einen Bettler siehst, gibst ihm einen Groschen." [...] Und ich sehe die Kinder, und bevor ich mich so richtig umdrehe, sind die zwei Gschroppen verschwunden. Und ich denke: "Mein Gott, wo sind denn die hin?" Ich wollte ihnen doch was geben. Ich wollte ihnen so gerne etwas geben und laufe herum, schaue da und da, habe mich dadurch verspätet, und ich komme zu unserem Haus und sehe: Die Mutter steht schon beim Fenster und schaut heraus. Da habe ich so eine Wut gehabt und habe meine Schultasche hingehaut und gesagt: "Es gibt doch überhaupt keinen Gott. Ich glaube nicht an Gott. Was ist das für ein Gott, der so kleine Kinder bettelnd, bloßfüßig im Winter herumlaufen lässt?" Und seit damals habe ich überhaupt keine Beziehung mehr zur Religion. [...]
Nach der Handelsschule bin ich dann in ein jüdisches Konfektionsgeschäft gekommen. Später wechselte ich zu der Firma Apfel & Co. Das war ein Textil- und Konfektionsgeschäft im 1. Bezirk, in der Sterngasse 2. Dort habe ich gearbeitet, bis das Geschäft "arisiert" worden ist. Das ist 1938 gleich "arisiert" worden. Ich habe in der Buchhaltung gearbeitet, habe auch Korrespondenzen übergehabt. [...]
Der erste Anstoß zur politischen Arbeit kam eigentlich durch meine jüngste Schwester, Sali, die Verbindung zu den Studenten gehabt hat, und zwar zu den kommunistischen Studenten. Da hat sie einen Freund gehabt, der hat schon dort mitgearbeitet, und wir haben gesagt: "Also gut, wir tun mit." Das war schon in der illegalen Zeit, etwa 1936, 1937. [Die KPÖ wurde am 26. Mai 1933 durch die Regierung Dollfuß verboten.] Wir Mädchen haben uns dann alle bei dieser Studentenbewegung betätigt. Mein Bruder natürlich nicht. Er hat es von uns gewusst, hat uns aber nichts in den Weg gelegt. Die Mutter auch nicht. Wir konnten weggehen und haben Zeitungen verbreitet. Es war eine schwere, illegale Zeit. Wir haben versucht, im Bekanntenkreis zu diskutieren. Damals ging das noch, es war doch etwas freier als später unter Hitler. Unsere Gruppe ist zeitweise zusammengekommen, aber sehr sporadisch. Also, man ist nicht ständig zusammen gewesen, man hat sich nicht nach dem wirklichen Namen gekannt, nur einige, mit denen ich persönlich bekannt war. Wir sind auch manchmal im Wienerwald zusammengekommen, oder wir haben uns bei jemandem getroffen. Da gab es zum Beispiel einen Schneider, der ein offenes Geschäft gehabt hat. Bei dem war eine Anlaufstelle, da sind wir hingekommen. Es waren ziemlich konspirative Zusammenkünfte, man sollte ja möglichst wenige Namen und Adressen wissen. Wir haben für die Rote Hilfe gearbeitet, gesammelt, kassiert. Zu unserer Tätigkeit zählte auch das "Steckengehen": Illegales Material, das wir bekommen haben, die "Rote Fahne" [Zentralorgan der KPÖ] oder Flugblätter, wurde in Häusern verteilt. Wir sind schnell von oben nach unten gelaufen und haben das Material an jede Tür gesteckt. Meistens zum 1. Mai. Wir haben von oben begonnen, nur von oben. Das hat man eingetrichtert gekriegt. Ich habe auch Material zu Leuten unserer Gruppe gebracht, die ich gar nicht gekannt habe. Da hat man mir gesagt: "Du gehst dort und dort hin." Da habe ich eine sehr lustige Erinnerung: Wir waren in gewisser Beziehung wirklich dumm aufgezogen worden. Ich hätte einen Jungen treffen sollen, hatte natürlich Material bei mir. Treffpunkt war eine Straße im 2. Bezirk, und ich gehe so auf und ab, ich habe sehr jung ausgesehen, ich habe Zöpfe gehabt. Und auf einmal kommt einer zu mir und sagt: "Schau, dass du wegkommst, du hast da nichts zu suchen." Und ich habe mir gedacht: "Was geht das den an?" Ich war so kindisch, so blöd, ich habe gesagt: "Ich warte hier auf jemanden." "Aber, schau, dass du wegkommst, sonst wirst du gleich eine erwischen!" Na, war das eine Straße von Huren, also von diesen Mädchen, die da auf die Straße gehen, und die haben geglaubt, dass ich mich da herstelle, um auch Kunden zu kriegen, und jetzt bin ich natürlich davongelaufen und habe mich auf die andere Seite gestellt und gewartet, bis der Junge gekommen ist, dann habe ich ihn gerufen und ihm das Material gegeben. [...]
Die Gruppe war schon straff organisiert, es war eine Zelle der Studenten, die natürlich auch mit anderen Zellen zusammengearbeitet hat. Ich weiß, dass nicht nur Studenten tätig waren, auch schon ältere, so wie ich. Man traf ein- bis zweimal im Monat zusammen, da wurde über Politik gesprochen. Aber eine richtige politische Schulung hatte ich nicht.




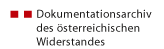







 English
English Termine
Termine Neues
Neues