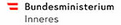Robert Adler, geboren 1913 in Wien, Sohn des austromarxistischen Theoretikers Max Adler (1873-1937), 1927 Austritt aus der Israelitischen Kultusgemeinde, Studium der Physik, Promotion 1937, Arbeit bei einem Patentanwalt. 1939 über Belgien nach Großbritannien, von dort im Juni 1940 in die USA.
Verstorben 2007 in den USA.
Mittlerweile hatte ich eine Freundin, die ziemlich schnell nach dem "Anschluss" nach Brüssel gefahren ist. An die habe ich meine Anzüge geschickt, meine Hemden, meinen Rechenschieber. Ich wollte ihr nach Belgien nachreisen. Später war das dann nicht möglich. Im März 1939 habe ich endlich - ich habe vollkommen vergessen wie - ein englisches Besuchervisum bekommen und dann ein belgisches Transitvisum - "sans arrêt", ohne Aufenthalt. So bin ich sehr gemütlich mit dem Zug nach Brüssel gefahren, gar nicht bei Nacht und Nebel wie viele andere. Ich habe phantastisches Glück gehabt. Vielleicht wegen meiner blonden Haare hat man mich nie auf der Straße belästigt. Ich habe von Wien aus ein Affidavit für die USA gehabt, und zwar hatte ich einen entfernten Verwandten, der war ein Arzt in New York. Er war in den zwanziger Jahren in Wien gewesen, um ein postuniversitäres Studium zu absolvieren. Der hat meine Mutter gut gekannt, mich ja kaum, ich war damals ein kleiner Bub. Das Affidavit war aber nicht genug. Die amerikanischen Behörden haben gesagt, man braucht mehr: "Du hast nicht genug Geld auf der Bank", oder was immer. Das hat sich dann natürlich lang gezogen.
Mittlerweile habe ich irgendwie das englische Besuchervisum gekriegt. Dann bin ich also mit der Bahn nach Brüssel gefahren. [...] Das Erste, was ich gemacht hab', war natürlich in Brüssel aussteigen schließlich und endlich war doch meine Freundin dort. Ich bin mit dem Zug über Aachen gefahren. Da musste man sich an der Grenze vollkommen ausziehen. Die Deutschen haben geschaut, dass man ja nichts schmuggelt. Die Belgier haben sich um überhaupt nichts gekümmert, solange man einen Pass hatte.
Meine große Überraschung kam noch. Die ersten paar Minuten in Brüssel habe ich was gelernt. Meine Freundin sagte mir: "Du musst deinen Pass sofort verstecken!" "Verstecken?" Ich war so stolz. Ich habe einen gültigen Pass! "Den musst du sofort verstecken!", sagte sie. "Du hast doch ein Visum 'sans arrêt'! Sonst schmeißen sie dich sofort raus und schicken dich nach England. Du willst doch hierbleiben ein bisserl, nein?" Ich: "Na, wie macht man denn das?" Sie: "Du gehst zum Gemeindeamt hier in Brüssel und sagst ihnen, du bist irgendwie über Nacht hergeführt worden, du hast keine Ahnung, wo du über die Grenze gekommen bist. Du kennst dich nicht aus. Und da geben sie dir einen Zettel, dass du dich hier angemeldet hast. Das macht dich mehr oder weniger legal in Brüssel." Eine verrückte Welt! Du hast einen gültigen Pass, aber du darfst ihn der Behörde nicht zeigen!
Ich bin aufs Gemeindeamt gegangen. Da war eine sehr freundliche Dame. Die hat mich gefragt: "Wie sind Sie denn über die Grenze gekommen?" In meinem holprigen Französisch habe ich ihr gesagt, dass ich während der Nacht gekommen bin, und ich wusste ja wirklich nicht, wo ich war. Sie hat die Geschichte wahrscheinlich schon viele tausende Male gehört. Sie hat gelächelt, hat das aufgeschrieben und mir ein Stückerl Papier gegeben und hat noch mehr gelächelt und mir einen schönen Aufenthalt gewünscht. Dadurch habe ich quasi halb-offiziell bleiben können.
Meine Freundin hat dann auch ein Visum nach England bekommen. So sind wir im Juni, zweieinhalb Monate später, nach England gefahren, mit allen unseren Siebensachen. Wir hatten eine Menge Kram. Denn alle Sachen, die ich ihr geschickt hatte, meine Schreibmaschine, alle meine Anzüge, und ihre Sachen natürlich. Sie war schon fünfzehn Monate in Brüssel, im Wesentlichen seit dem "Anschluss". Sie hat sich wirklich schon wie eine "Bruxelloise" [Einwohnerin von Brüssel] gefühlt.
Wir haben immer versucht, Geld zu sparen, denn wir hatten keines. Von Zeit zu Zeit hat mir mein Onkel in Paris ein bisserl was geschickt. Wir haben sehr spartanisch gelebt. Am Donnerstag hat das lokale Kino Filme gewechselt. Da konnte man um drei Uhr hingehen und dort bis elf sitzen und vier verschiedene Filme sehen für einen Eintrittspreis. Dann haben sie uns noch einen Gutschein gegeben, der einen belgischen Franc abzieht beim nächsten Mal. Während der Zeit hat man nichts gegessen. Da hat man viel Geld erspart. Wir waren ein bisserl hungrig. Man durfte keine Arbeit annehmen. Aber es gab verschiedene Hilfskomitees, die sich um Flüchtlinge angenommen haben. Man musste sehr aufpassen: Nicht zuviel zu Fuß gehen, damit die Schuhe nicht repariert werden müssen und so Kleinigkeiten. [...]
Auf dem Weg nach England habe ich ein furchtbar schlechtes Gewissen gehabt wegen meines "sans arrêt". Ich war doch drei Monate dort und der Datumstempel war im Pass! Und ich habe mir gedacht, was die mir für Schwierigkeiten machen werden! Trude, meine Freundin, andererseits hatte einen funkelnagelneuen Pass mit einem englischen Besuchervisum. Sie hat sich wie eine Belgierin gefühlt. Ihr Französisch war zu der Zeit schon ausgezeichnet. Als wir in Oostende angekommen sind, haben wir beschlossen, dass sie zuerst die Grenze betreten soll, in der Annahme, dass bei ihr doch sicher nichts beanstandet werden würde. Nun haben sie Trude aber furchtbare Schwierigkeiten gemacht. Der Grenzbeamte hat gesagt: "Können Sie beweisen, dass Sie sich in Brüssel bei der Gemeinde angemeldet haben?" Sie hatte natürlich ihren Zettel verloren. Es war leicht, so etwas zu verlieren, mit all dem Kram, den wir gehabt haben. Er: "Ist da nicht irgendetwas, das Sie verwenden können, um zu beweisen, dass Sie sich in Brüssel angemeldet haben?" Ein belgisches Dokument ist nicht schwer zu erkennen, weil es zweisprachig ist, Flämisch und Französisch. Da suchte sie mehr oder weniger pro forma in ihrer Tasche herum. Plötzlich sah der Mann etwas, das wie ein belgisches Dokument aussah, und fragte sie: "Was ist das?" Sie zog es heraus. Es war ein Zettel vom Zollamt, den sie bekommen hatte, als sie meine Schreibmaschine vom Zollamt abgeholt hatte. Da war natürlich ein Datum drauf, das schon einige Zeit zurücklag. Jedoch war es ein offizielles Dokument, das bewies, dass sie mit irgendeiner Behörde in Brüssel Kontakt gehabt hat. Das bedeutet normalerweise gar nichts. Die hätte ja ein Räuber oder Mörder sein können, aber für den Zollbeamten war das genug. Der hat doch irgendein Papierl gesucht, um sagen zu können: "Also geh' schon." Er las das und sagte: "Wo ist diese machine à écrire [Schreibmaschine]?" "Da ist sie ja!", sagte ich. "Also ist alles in Ordnung." Er hat eine Kopie von dem genommen, sie unterschrieben, uns die andere Kopie zurückgegeben und gesagt: "Also gehen Sie beide." Meinen Pass hat er fast nicht angeschaut, hat ihn doch noch gedreht. Man konnte sehen, dass er das "sans arrêt" liest. Er hat jedoch kein Wort gesagt, außer: "Also geht's!"
Ich bin dann ungefähr ein Jahr in England geblieben. England war in vieler Hinsicht eine Überraschung. Erstens einmal war es das erste wirklich fremde Land, obwohl ich Englisch sprechen konnte und die Leute verstanden habe. Es war viel fremder als Belgien, die Engländer waren vor dem Krieg noch so vollkommen vom Kontinent getrennt. Europa war eine ferne Welt für die Engländer. Indien, Kanada waren ihnen viel näher. Dazu waren diese Engländer so selbstsicher und ruhig und haben sich über nichts aufgeregt. Sie waren so anders als wir, die immerfort um etwas besorgt waren. Aber dann nach kurzer Zeit fand man heraus, dass da noch eine andere Seite war: Die Leute waren extrem hilfsbereit. Es gab alle möglichen Komitees, die sich für Flüchtlinge eingesetzt und ihnen geholfen haben. Und für jeden gab es etwas. In meinem Fall, weil ich konfessionslos war, haben sich die Quäker, die Society of Friends, um mich angenommen. Zum Beispiel haben sie mich für eine Woche zu einem älteren Ehepaar nach Surrey, Südengland, geschickt. Aus der einen Woche wurden fünf. Die haben mich gebeten: "Willst du nicht noch ein bisserl länger bleiben?" Das waren schrecklich nette Leute, und ich habe natürlich für sie gemacht, was ich konnte. Ich habe ihnen im Garten geholfen, das Gras zu mähen und die Blätter zu sammeln. Es war schon Herbst. Die Hausfrau hat mir ihr Fahrrad geborgt und gesagt: "Warum gehst du nicht aus während des Tages, es ist so schön!" Surrey ist wirklich sehr, sehr schön. Eine herrliche Landschaft, ruhig und friedlich. Es ist sehr schwer, sich das jetzt vorzustellen. Das war schon im Krieg, aber das war der sogenannte Sitzkrieg, wo nichts vorgegangen ist.
Dann, etwa zu Weihnachten 1939, habe ich einen Posten gekriegt in London bei einer kleinen Firma, die jemanden gebraucht hat, der elektronische Messinstrumente entwerfen kann. Da habe ich wieder reines Glück gehabt. Die haben mir gesagtt: "Das Gesetz erfordert, dass wir die Labour Exchange" also die Behörde "informieren, dass wir keinen Engländer finden können, der das macht." Die haben mir erklärt, das ist nur eine Formalität, denn solche Fachkräfte sind sehr schwer zu finden. Für mich war es eine sehr interessante Arbeit. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Vollzeit-Posten gehabt habe. Es war wirklich eine neue Erfahrung, jeden Morgen mit der Untergrundbahn zur Arbeit zu fahren, und ich habe mich wirklich schon wie ein Londoner gefühlt.
Dann, drei Wochen nachdem ich den Posten gekriegt habe, ist der Brief vom amerikanischen Konsulat gekommen. Ich habe das Konsulat angerufen und mich krank gemeldet. Ich habe gesagt: "Ich habe einen schrecklichen Schnupfen, ich kann jetzt nicht kommen." Ich wollte mir das überlegen. Ich habe einen interessanten Posten gehabt, ich habe mich den ganzen Tag im Laboratorium herumgespielt und dafür sogar Geld bekommen. Ich meine, schöner kann es doch nicht sein! Ich habe angefangen, ein paar englische Freunde zu haben. Ich habe noch in einem großen Zimmer in Nordwest-London gewohnt, zusammen mit zwei anderen Wiener Burschen. Die waren auch in derselben Lage. [...] Alle meine Freunde haben mir gesagt: "Du bist ja verrückt, wenn du nicht nach Amerika gehst! Du bist doch ein Techniker. Das ist doch das gelobte Land der Techniker. Wer weiß, was aus England wird. Der Krieg! Es wird ja nicht so ruhig bleiben. Eines schönen Tages wird er ausbrechen. Wer weiß? Die Engländer sind nicht gut vorbereitet. Wer weiß, vielleicht kommen die Nazis herüber. Was machst du dann? Sei doch nicht blöd, geh' nach Amerika!"
So bin ich schweren Herzens zum Konsulat gegangen, habe das Visum abgeholt und bin buchstäblich im letzten Moment, im Juni 1940 - das Visum war nur vier Monate gültig , nach Amerika gefahren. [...]
Wir sind - es war ja schon Krieg - mit dem Konvoi herübergefahren, auf einem Passagierschiff, das von anderen verschiedenen Schiffen und ein oder zwei kleinen Kriegsschiffen begleitet wurde. Es hat neun Tage gedauert, und ich war schrecklich seekrank. Es war ein großes Geheimnis, wo wir landen werden, alles wegen der U-Boote. Wir sind dann in Montreal angekommen. Es waren sechs von uns, die nach New York fahren wollten. Da haben sie uns Karten gegeben für den Zug von Montreal nach New York. [...]
So sind wir in New York angekommen. Ich hab' dann durch irgendwelche Freunde oder Bekannte einen Patentanwalt kennengelernt. Der hat mit Interesse gehört, dass ich in Wien für einen Patentanwalt gearbeitet habe, und mich gefragt: "Wollen Sie vielleicht, solange Sie nichts anderes haben, für mich ein bisserl arbeiten?" Ich war natürlich sehr glücklich darüber und fragte ihn, worum es sich handeln würde. Sagte er: "Ich habe hier eine Beschreibung einer Erfindung. Die hat jemand geschrieben, der wirklich nicht schreiben kann. Es ist furchtbar verwirrend, und es würde furchtbar viel Zeit in Anspruch nehmen, da etwas Klares daraus zu machen. Außerdem hat er noch eine Zeichnung beigelegt, die mit fünf verschiedenen Farbstiften gemacht ist, und unser amerikanisches Patentamt erlaubt nur schwarz und weiß. Also bitte nehmen Sie das und versuchen Sie, etwas daraus zu machen, was Hand und Fuß hat. Und wenn Sie erfolgreich sind, bitte bringen Sie es mir."
Schön! Und ich habe nichts anders zu tun gehabt. Da bin ich also in diesem ganz kleinen Zimmerchen, das ich gemietet hatte mit dem Geld meines entfernten Verwandten, gesessen, und Gott sei Dank hatte ich die berühmte Schreibmaschine, von der ich schon erzählt habe, und habe also versucht, diese Erfindung zu verstehen. Und nachdem ich glaubte, ich hätte sie verstanden, habe ich sie in meinem besten Englisch - das war gar nicht so schlecht, das geschriebene Englisch - beschrieben und auch eine neue Zeichnung gemacht und habe ihm das Resultat gebracht. Er hat gesagt, er will es sich zuerst anschauen. Dann hat er mich am nächsten Tag angerufen und mich gefragt: "Sagen Sie, wollen Sie bitte für mich arbeiten?" Ich war ganz erstaunt. Sagt er: "Was Sie da gemacht haben, ist sehr gut. Nicht nur kann ich es verstehen, sondern ich muss wirklich nicht viel ändern. Man muss natürlich Änderungen machen, um den formalen Anforderungen des amerikanischen Patentamtes gerecht zu werden. Aber es ist wirklich gar nicht mehr viel Arbeit. Sie haben mir viel Mühe erspart. Also kommen Sie her und holen Sie sich Ihren Scheck ab, und dann reden wir noch ein bisserl." Ich hatte ein bisserl Zeit, darüber nachzudenken. Da habe ich etwas gemacht, was ich nicht bereut habe. Aber damals ist es mir ein bisserl schwummerlich vorgekommen. Ich habe ihm gesagt: "Nein, schauen Sie, es ist sehr interessant, und ich möchte das gerne machen. Aber ich kenne mich selber gut genug. Wenn ich drei Monate für Sie arbeite, und dann finde ich einen Posten in einem Laboratorium, wo ich ein paar Knöpfe drehen kann, gehe ich doch von Ihnen weg. Ich will doch nicht nur Papierarbeit machen. Ich möchte doch in einem Laboratorium arbeiten. Früher oder später würde ich doch wieder von Ihnen weggehen, und dann sitzen Sie wieder da. Also wenn Sie jemanden brauchen, wäre das ganz ungerecht, das anzunehmen." So habe ich diesen Posten nicht gekriegt. Ich habe dann später durch einen Freund wieder eine Chance erhalten. Der hat einen Posten in Chicago verlassen und mich rekommandiert. Es war nichts Besonderes, aber es war eine gute Einführung: Ein Ingenieurposten, sehr primitiv. Ich habe sorgfältig mein Doktorat verschwiegen, denn sonst hätte ich den Posten nicht gekriegt, weil ich überqualifiziert gewesen wäre. Aber für mich war es viel wichtiger, einen Posten zu bekommen, und außerdem hatte ich viel an praktischen Dingen zu lernen. Amerikanische Bestandteile habe ich gar nicht gekannt und Fachausdrücke nicht sehr gut. Ich habe ein paar in England gelernt, aber nicht genug. Das Wichtigste an der Arbeit war, dass ich gelernt habe, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, besonders mit weniger geschulten. Damals - ich glaube, heute ist es in Österreich auch so - musste man in Amerika unbedingt lernen, einander bei der Arbeit zu "häkln" [Wienerischer Ausdruck für "einander spaßhalber zu ärgern"]. Man durfte dabei aber nicht böse werden - steifer Kragen, das ging nicht! Ich erinnere mich noch, wie ich zitternd und bebend das erste Mal versucht hab', einen meiner jüngeren Kollegen aufzuziehen. Das war erfolgreich, Gott sei Dank, sonst hätte ich es vielleicht nie gelernt. Den Posten habe ich dann anderthalb Jahre gehabt, danach einen interessanteren.
Amerika hat sich - für mich wenigstens - als das gelobte Land der Techniker herausgestellt.




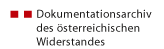






 English
English Termine
Termine Neues
Neues