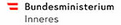Karl Rössel-Majdan, geb. 1916 in Wien, Jusstudium. Nach dem "Anschluss" Aufbau einer illegalen Studentengruppe. Herbst 1938 Mitbegründer der "Großösterreichischen Freiheitsbewegung". 1939 Einrücken zur Deutschen Wehrmacht. Festnahme am 22. Oktober 1940, am 29. Juni 1944 vom Volksgerichtshof wegen "Vorbereitung zum Hochverrat" zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. März 1945 Flucht aus dem Zwangsarbeitslager Wien-Lobau, lebt bis Kriegsende als "U-Boot" bei einem Bekannten, Beteiligung an den Kämpfen in Wien.
Nach Kriegsende Promotion zum Dr. phil. und Dr. rer. pol., als Schriftsteller tätig, leitende Funktionen u. a. im ORF.
Verstorben 2000.
Ich begann sofort mit der Arbeit an der Universität: Studenten suchen, von denen ich annehmen konnte - man musste bereits äußerst vorsichtig vorgehen -, dass sie Gegner sind, ganz gleich welcher Couleur. Sehr befreundet war ich dann mit dem Juden [Walter] Hecht - sein Vater war Rechtsanwalt, ihm selber ist es dann gelungen, nach England zu emigrieren - und habe mit ihm vereinbart, dass wir miteinander in Geheimverbindung bleiben, sodass ich nach England berichten kann an die österreichischen Emigranten dort bzw. umgekehrt Nachrichten von dort erhalte, wie die Sache weitergeht. Durch ungarische Bekannte war mir klar, dass von Budapest aus noch gewisse Verbindungen zum Ausland möglich waren, denn Budapest hatte eine freiere Stellung bei Hitler. Ich fuhr daher dann mehrfach mit dem Schiff oder auch mit dem Zug nach Budapest und habe durch Vertraute im Kynologen-, also Hundezüchterverband mit England korrespondiert, und zwar mit synthetischer Tinte einfach auf Karten, Postkarten, Briefen, Paketen, das Einpackpapier war imprägniert, und man hat das dort dann aufgelöst und konnte die Nachrichten lesen. [...] Die Geheime Staatspolizei ist mir nie auf diese Spur gekommen. Ich hatte aber dadurch Frontberichte, und wahrscheinlich ist es dort auch entsprechend weitergegangen. Später, nach den Verhaftungen, war das natürlich auch unterbrochen. Die Widerstandsbewegung begann also erstens in dieser Studentengruppe, wo ich sozusagen vom ersten Tag oder vom dritten Tag an gearbeitet hab; eine kleine Gruppe, wo ich versucht habe, sofort Decknamen einzuführen, niemand weiß des anderen Namen, damit keiner gefährdet ist bei dieser Radikalität der Nazi, daher also keine Adressen, Handschlag muss genügen, man muss sich verlassen können auf den anderen. So wurde das aufgebaut, war eine kleine Gruppe.
Dann kam 's zum Sudeteneinmarsch. Ich wurde eingezogen als Offiziersanwärter im Rang eines Unteroffiziers zur schweren Artillerie. Bei dieser schweren Artillerie [...] waren viele frühere Taxifahrer und Chauffeure von Fabriken usw. Die waren meistens Sozialisten, und es war daher leicht, einen guten Kontakt aufzunehmen. Es ging in den Nächten im Zickzack durchs Waldviertel, so wurden geheim die Stellungen bezogen, und dann kam der Druck und die Drohung gegen die Tschechoslowakei. Wir haben damals noch gehofft, die Tschechoslowakei würde Widerstand leisten. Wir haben vorbereitet, am Tag, zur Stunde Null, wenn es losgehen soll, die Geschütze umzudrehen, Richtung nach rückwärts, und die Front aufzureißen. Es war gut vorbereitet. Knapp bevor die Tschechoslowakei dann kapituliert hat, ging ich auch wieder einmal so von Bunker zu Bunker - es waren Notbunker errichtet -, um Leute aufzusuchen, auf die Seite zu nehmen, mit ihnen zu sprechen und so. Da sah ich, auf einem Bunker stehend, den Sozialisten [Johann] Schwendenwein, den ich dann kennen lernte. Ich hatte immer nur gehört, da ist einer tätig, hatte aber nie herausbekommen, wer das ist. Da stand er jetzt offen am Bunker, denn am nächsten Tag, hat man erwartet, geht 's los, und hat eine Brandrede gehalten für den Widerstand. Ich hab ihn sofort begrüßt, wir haben Freundschaft geschlossen. Als am nächsten Tag die Tschechoslowakei kapituliert hat, war 's natürlich äußerst gefährlich, und wir haben beschlossen, uns in Wien zu treffen und gemeinsame Sache zu machen, er als Sozialist, ich als Parteiloser mit meinen Studenten. Er sagte mir, es gäbe einen gewissen Jakob Kastelic, der von den früheren Sturmscharen sei, ein katholischer Rechtsanwalt, absolut verlässlich, den kenne er und wir müssen zusammenarbeiten.
Wir trafen uns dann in Wien im Café "Wunderer" in Hietzing und haben dort vom Aufbau einer gemeinsamen Widerstandsbewegung gesprochen, einigten uns auf den Namen "Freiheitsbewegung" bzw. "Österreichische Freiheitsbewegung", später "Großösterreichische Freiheitsbewegung", weil man gedacht hat, der Aufstand soll Ungarn und die Tschechoslowakei und alles erfassen, wenn 's einmal soweit ist. Auf der Linie des Überparteilichen haben wir uns geeinigt. Meine Funktion war dabei Jugendberatung und staatsrechtliche Vorbereitung, d. h. neue Ideen auch in der Reform der Demokratie, damit nicht dasselbe wie vorher passiert und wieder irgendein Hitler daherkommt. Hab mich dann intensiv aufgrund meines Studiums mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Es gab immer wieder geheime Besprechungen. Im Allgemeinen war der Kreis sehr klein gehalten, das Prinzip wurde allgemein akzeptiert: keine Namen, keine Adressen, Handschlag genügt, Deckname, man trifft sich, jeder kennt immer nur zwei, das war also das Prinzip. So haben wir langsam und zäh aufgebaut.
[1939] hab ich mein Studierzimmer gehabt bei einer Verwandten, bei einer Tante, die einen Kindergarten hatte in der Siebensterngasse, und hab gesehen, wie dort unter riesigem Pomp und mit SS, SA, Blechmusik, Polizei usw. diese Gedenktafel für Planetta und die Julikämpfer enthüllt wurde, an der Mauer des früheren Turnsaales. [Von der Siebensterngasse fuhren am 25. Juli 1934 die NS-Putschisten ins Bundeskanzleramt. Der mutmaßliche Mörder Dollfuß' Otto Planetta wurde am 31. Juli 1934 hingerichtet.] Es war mir geradezu ein Auftrag: da, wo ich wohne, passiert so etwas - irgendein Meisterstück in der Widerstandsbewegung muss jeder leisten! Zwar war gegenüber die Wachstube, und es ging ja auch ein Posten dort auf und ab, aber es war klar für mich, das muss weg, das Denkmal. [...] Ich hab dann ein diesiges Wetter benützt, hab herausbekommen, dass das Sandstein ist, die ganze Tafel. Sandstein saugt ja Verschiedenes auf. Ich hab eine Füllfedertinte oder Tusche genommen, Tusche dürft das gewesen sein, und bin mit einem Fahrrad, Windjacke, Kragen aufgestellt, die Siebensterngasse langsam abwärts gerollt, hab die Situation beobachtet. [...] Es gelang mir dann also, dort einen Moment zu stoppen und dieses Fläschchen über die Tafelschrift drüberzuspritzen. Die Tafel war total schwarz bekleckert, und das hat sich hineingesaugt. Ich bin sofort mit dem Fahrrad durch die nächste Seitengasse abgehauen, nach verschiedenen Winkelstraßen immer beobachtend, ob ich verfolgt werde. Wie ich sicher war, dass es nicht der Fall ist, bin ich vom Umweg Favoriten nach Haus gekommen. Am nächsten Tag war ich an der Universität, und als ich zurückkam, war ich neugierig, was da passiert. Ich ging die Breite Gasse hinauf, bog in die Siebensterngasse ein, da war alles schwarz von Menschen, eine Versammlung und überall Polizei und natürlich die SS-Uniformen, und auf zwei Leitern standen Steinmetze und haben diese Tafel herausgestemmt. Da hab ich mir gedacht: "Gelungen!" Es hat am selben Tag noch der Straßburger Sender die Nachricht gebracht. Ich habe mich unter die Passanten gemischt, habe gefragt: "Was ist denn da los?" - "Ja, stellen Sie sich vor, in der Nacht sind Kommunisten mit Lastwagen vorbeigefahren und haben mit Spritzgewehren auf diese Tafel gespritzt." [...]
Einmal fand ein Treffen statt an Hitlers Geburtstag [20. 4. 1940], nachdem zwischen unserer Freiheitsbewegung und anderen, also das ist die Scholz-Bewegung und die Lederer-Bewegung gewesen, ein Kontakt entstanden ist. Langsam, vorsichtig, man hat die Fühler ausgestreckt gehabt und war aneinander gestoßen. Treffpunkt in der Prinz-Eugen-Straße, ich weiß nicht mehr, wessen Wohnung es war, und dort kam ich auch hin. Mein Deckname war "Georg Michael". Da traf man sich, und nun war Lederer sehr unvorsichtig und hat für die Anlage eines Adressenverzeichnisses plädiert, das müsste man geheim anlegen, in einem Lexikon etwa die Buchstaben anzeichnen usw. Ich bin radikal dagegen aufgetreten und hab gesagt, das ist nur eine Gefährdung, das hat gar keinen Sinn, wo man sich nicht verlassen kann auf den Handschlag in der Widerstandsbewegung, da ist ohnehin alles vergeblich. Wir haben dann auch besprochen, wie man sich Waffen beschaffen könnte, wie an einem bestimmten Stichtag Polizeikommissariate besetzt werden und wie man also da vorgehen könnte, um die Befreiung einzuleiten. Aber ich hab immer zur größten Vorsicht gemahnt. Nun hatte ich eine Gewohnheit - ich hab einen Notizkalender bei mir geführt, einen winzig kleinen Notizkalender, hab aber dort immer die "positiv" scheinenden Sachen eingetragen bzw. was "negativ" war im gegenteiligen Sinn eingetragen. Ablehnung eines Zusammenschlusses stand [da], Ablehnung von Waffen, Ablehnung von Mitgliedskarten usw., das sei also das Resultat dieser Sitzung gewesen. Das hat später manchen den Kopf gerettet, die unvorsichtig waren. [...]
Ich war zum Militär eingezogen, musste in Wels Dienst machen, hab dort zum letzten Mal meinen Bruder gesehen, der auch eingezogen war. [...] Er hatte dann Pferde nach Linz zu führen, dort abzugeben, in der Kanzlei wurde er von Herumstehenden gefragt: "Na, wie war 's in Polen?" Und er hat gesagt: "Na ja, die Polen sind überrannt, aber der Krieg geht ja doch für Hitler verloren." Er wurde angezeigt von der Stenotypistin dort. Er wurde vors Gericht gestellt in Linz, der Richter war mit einer fünfjährigen Strafe nicht einverstanden, und er kam dann ins KZ nach Emsfelde an die holländische Grenze, weil 's ja immer Gepflogenheit war, die politischen Gefangenen ans andere Ende des Reichs zu schicken, damit sie nicht Angehörige in der Nähe haben. Dort ist er elend umgebracht worden. [Viktor Rössel-Majdan starb am 6. Februar 1944 im Strafgefangenenlager III Brual-Rhede, einem Straflager der Reichsjustizverwaltung im Emsland.] Er musste in der Torfstecherei arbeiten, bis an den Hüften oft im Wasser stehend, ist geprügelt worden und [war nur noch] Haut und Knochen und Eiterbeulen. [...]
Ich hatte mich geweigert, an der Weihnachtsfeier in Wels teilzunehmen, weil ich wusste, da wird wieder auf Hitler ..., werden Reden geschwungen und man muss wieder mit "Heil Hitler" grüßen, was ich immer verweigert hatte. Ich hatte ja das Hoheitsabzeichen von meiner Uniform gerissen, das hab ich nie angenommen, wurde immer wieder zurückgeschickt zur Schneiderei, um mir eins draufnähen zu lassen, hab es, noch aus der Schneiderei gehend, immer heruntergerissen. Ich hab also das Hakenkreuz nie tragen wollen und den "Hitlergruß" nicht geleistet. Bei der Vereidigung hab ich deutlich das Gegenteil geschworen, nur war 's noch so, dass neben mir solche standen, die 's gehört haben und die mich eben nicht angezeigt haben. [...] Ich hab den Posten abgelöst, der am Tor der Kaserne stand, hab g'sagt: "Du gehst gern zur Feier, geh dorthin, ich steh freiwillig hier als Unteroffizier." Das hat der Offizier sehr wohl kapiert gehabt, dass das solche Gründe hat, und hat mich strafversetzt an die Front. [...]
Dann kam der Angriff auf Frankreich, die Geschütze sind aufgefahren gegen die Maginot-Linie. Es war bespannte Artillerie, ich hatte zwei Geschütze und wusste nach der Karte, es wird geschossen auf Fluchtwege, wo Frauen und Kinder aus dem französischen Maginot-Linie-Gebiet zurückgezogen werden - dieses Schießen wird ein furchtbares Blutbad anrichten. Da ging ich heimlich - konnte mit niemandem reden, weil es war viel zu gefährlich -, ging heimlich immer zu den Geschützen und hab die Daten an den Geschützen etwas verstellt, sodass sie in eine sumpfige Wiese geschossen haben und dort immer "plupp", also ergebnislos, explodiert sind. Das war am Tag des Angriffes, am nächsten Tag noch kam ein preußischer Offizier, brüllend: "Welches Schwein da oben schießt immer daneben?" Aber es hieß schon aufsitzen und wieder weiter, und dadurch konnten die der Sache nicht weiter nachgehen. [...]
[Nach einer Verletzung wurde Karl Rössel-Majdan im Frühjahr 1940 nach Österreich transportiert.]
Ich lag damals in Vöcklabruck, konnte mich nicht rühren und vor Schmerz meist nicht schlafen, war daher in der Nacht wach und hörte an der vorbeigehenden Bahnlinie immer lauter Züge fahren in der Nacht. Die Achsen mussten schwer beladen sein, am Rattern zu schließen, und ich habe begonnen, dieses Rattern zu zählen und daher Waggons abzuschätzen. Ich hab dann einen Brief geschrieben an Bekannte in Vöcklabruck, und zwar, dass meiner Meinung nach ein Aufmarsch gegen den Balkan geschehen muss, denn das müssen schwere Geschütze sein, da werden Panzer transportiert in der Nacht, ich schätze auf soundso viel Divisionen. Dieser Brief war noch nicht adressiert, lag noch auf meinem Nachtkästchen, aus Ermüdung war ich in der Früh eingeschlafen. Der Gefreite, der die Post einholte, hat den Brief mitgenommen, bei der Post haben die gesehen: keine Adresse darauf, haben aufgemacht, haben hineingeschaut und haben sofort Anzeige bei der Polizei gemacht. [...] So wurde ich von da an als Spion beschattet; man hat aber nichts gefunden. Obwohl ich dann in Wien im Lazarett [lag], dort wurde ich operiert, bin ich dann in der Nacht an der Regenrinne heruntergekrochen oder hab mich durch den Keller geschlagen, hab den Weg hinaus gesucht zur Widerstandsbewegung - in der Früh lag ich immer wieder in meinem Bett! Man hat mich dabei nie erwischt. Aber eines Tages dann [im Oktober 1940], vermutlich durch Verhöre in der Widerstandsbewegung, hat man sich gedacht, der müsste irgendwo mit der Freiheitsbewegung zu tun haben. Die ärztliche Visite blieb aus, alle mussten neben den Betten stehen, und dann kamen zwei Herren herein, Gestapo, Geheime Staatspolizei. "Räumen Sie Ihr Bett aus!" Es wurde alles untersucht, ob da Waffen drin sind oder irgend etwas, was sie interessiert hätte, und dann musste ich mit ins Auto und ins "Metropole"zum Verhör. Zuerst in die Roßauer Kaserne und von dort am nächsten Tag ins "Metropole". Im "Metropole" war ich in einer Zelle hinter Gittern, auf einer Holzpritsche, davor ein Posten, tief unten im Keller, und wurde jeden Tag, 17 Tage lang, jeden Tag von früh bis abends verhört. Vom Moment der Verhaftung an war mir klar, jetzt ist mein Leben verwirkt, ich rechnete damit, dass ich wenige Tage vielleicht haben werde in der Folter, aber ich werde nicht überleben können. [...] Dort hat man mich hinaufgenommen dann in den soundsovielten Stock, SS mit Revolvern stand rundherum, sie müssen mich also für einen schweren Burschen angesehen haben. Ein Kommissar hat den Revolver sofort mit Mündung zu mir auf den Schreibtisch gelegt und das Verhör begonnen: "Sie, Sie werden die volle, reine Wahrheit sagen." Durch mein Hirn schoss: "Dein Leben ist verwirkt, jetzt musst du möglichst viel andere Leben retten. Deins ist soundso weg. Daher werd ich also auf mich nehmen, was immer sie sagen, ich werde es getan haben." [...] Jetzt ging es ziemlich friedlich zu, denn der hat mich alles Mögliche gefragt, wo ich nur ahnte, das könnte der oder jener gemacht haben oder wo ich gar nicht wusste, wer 's gemacht hat, ich hab alles auf mich genommen. Na ja, da kommt einiges zusammen in 17 Tagen Verhör. Die Verhöre wurden immer ruhiger, man hat gesehen, der Kommissar hat Zweifel, wann soll denn das gewesen sein usw., nicht? [...]
Ich wurde dann an das Kriegsgericht überstellt, weil ich ja vom Militär weg verhaftet war. Dort, in der Schiffamtsgasse, bestand Gefahr, dass ich nach Berlin transportiert werde und im Kasernenhof erschossen. [...] In Berlin ist inzwischen ein Bombenangriff erfolgt, und es hieß, die Akten müssen alle rekonstruiert werden. Das war wieder eine gewisse Hoffnung, ein Aufschub. Ich wurde dann ans Landesgericht überstellt und später nach München-Stadelheim hinaustransportiert. Das war 1941.
Vor meiner Verhandlung [29. Juni 1944] kam 's zu einem letzten Besuch der Eltern hinter Doppelgittern, innen und außen Bewachung. Mein Vater und meine Mutter waren da, mein Vater hat mir gesagt: "Du weißt, wie 's um dich steht, dein Verteidiger, der Nationalsozialist [Erich] Führer, hat gesagt: 'Es ist keine Chance auf Überleben, das müssen Sie wissen.' Verhalte dich entsprechend. Ich muss dir leider mitteilen, du sollst bewusst in den Tod gehen, dein Bruder ist im KZ umgekommen. Ich habe seine Leiche gesehen." Na, das war nicht einfach für mich, das wühlt alles auf, man überlegt, ob man wo die Heizung herausreißen kann und sich damit wehren kann. Man wird wie ein wildes Tier, das also in der Verzweiflung alles Mögliche tun will. Vor allem die Verzweiflung an dem Versagen der Menschen, das war das Allerärgste. Man kann als Freiheitskämpfer durch den Tod leichter durchgehen, wenn man weiß, irgendwo ist Idealismus und ist Gerechtigkeit. [...] Ich kam dann zur Verhandlung, es war einen Tag lang nur für mich eine Verhandlung, die andern waren ja schon alle verurteilt.
Der Prozess sah nun so aus, dass zuerst lange die Anklageschrift verlesen wurde: "Er ist ein Gegner, er bekennt sich dazu." usw. "Aber ...", und in der Aussage wurde jetzt in Frage gestellt, was ich wirklich gemacht habe. Das war diese Ungewissheit der Gestapo bei der ganzen Sache, weil ja dann eindeutig festgestellt [war], das haben andere gemacht, er ist also ein verrannter Idealist sozusagen. Dann kam ich ins Verhör. "Also, bekennen Sie sich schuldig?" Da hab ich gesagt: "Ich war immer gegen den Nationalsozialismus, bin so aufgewachsen." Hab eine ehrliche Haltung vertreten, aber mit einer Ruhe, ohne aggressiv zu sein. Und dann hat er mich plötzlich gefragt: "Ja, aber die Widerstandsbewegung, die wollte ja militant sein, die wollte ja das Reich stürzen, die wollte ja den Führer stürzen, da war doch das Treffen an Führers Geburtstag, wie war das, erzählen Sie jetzt!" Und drauf schoss mir durch den Kopf: "Mein Kalender!" Ich hab mir gedacht, hoffentlich ist er beim Akt und nicht in Berlin vernichtet worden. Na, hab ich gesagt: "Herr Vorsitzender, ich habe ja über alles einen Kalender geführt, der müsste eigentlich beim Akt liegen. Dort steht in Stenogramm alles, was sich ereignet hat, auch bei dieser Sitzung." - "Also, wo soll dieser Kalender sein?" Fangt er an zu blättern. Spannung, nicht? Dann zieht er den plötzlich heraus, den kleinen Kalender, ich hab ihn sofort erkannt. "Ist er das?" Ich sagte: "Jawohl, Herr Vorsitzender." Dann hat er drin geblättert: "Wann war das? Also 20. April." Hat dort zu lesen angefangen: "Hm, hm, hm ...", ich hab gesehen, er kann nicht Stenographie. Waren ja lauter Verbrechergesichter, und man hat 's ihnen angesehen, lauter Verbrecher in Uniform, SA-Uniform, Marine, SS und was weiß ich. Dann hat er 's dem Nebenmann gegeben dort im Senat, der hat auch mit seiner Hmserei angefangen. So ging das durch den Senat, alle haben 's gesehen, haben getan, als könnten sie 's lesen, haben genickt, und ich hab deutlich gesehen, keiner hat 's lesen können. Und dann nimmt er das und reicht 's herunter und sagt: "So, lesen Sie das vor!" Und jetzt konnt ich frei vorlesen. Und das war der Hauptgrund dann für meine Rettung. Vielleicht einerseits die Haltung, dass da keine Aggression entstand, andererseits also auch dieser Kalender, wo immer 's Gegenteil [stand]. Ich hab dann laut vorgelesen, es wurden abgelehnt irgendwelche Waffen, es wurden abgelehnt irgendwelche Mitgliederlisten, irgendeine Organisation, man ist zwar gegen Hitler, aber das gefährdet nur die Menschen, es hat keinen Sinn und so. Und danach dann hat sich der Senat zurückgezogen, hat lange gedauert, 's ging hin und her um meinen Kopf. [...] Zehn Jahre erhielt ich dann, und das war die Rettung. Da ging ein Aufatmen durch den ganzen Saal; es waren viele Menschen drin, auch Angehörige der schon Verhafteten, zum Teil schon Geköpften, zum Teil noch nicht, da ging also ein Aufatmen durch den ganzen Saal. [...]
Ich wurde in die Lobau versetzt. Das war ein eigenes Lager [...] mitten in den Auen, also möglichst versteckt, wo Benzin für die Kriegsdestillerie hergestellt wurde. Großes Territorium, mit mehreren Stacheldrähten umgeben natürlich, aber es wurden dort eingesetzt erstens Kriegsgefangene, Belgier und Franzosen, zweitens verschleppte Jugoslawen und Holländer, die zwangsverpflichtet waren, aber nicht politische Häftlinge und eigentlich nicht Kriegsgefangene waren. [In Wien-Lobau war vom Juni 1944 bis April 1945 ein Lager für ungarische Juden, die in der dortigen Mineralölfabrik eingesetzt wurden.] Die konnten daher mit einer Firma korrespondieren und Kontakt haben, weil da mussten immer schwere Kräne geholt werden usw. Die Amerikaner haben immer dichter bombardiert, aufs Lager kamen schon täglich drei Wellen von Flugstaffeln, die das bombardiert haben. Das war eine gewisse Chance, denn die Bomben haben auch Stacheldrähte zerschlagen. [...]
Ich wurde zugeteilt einer Schweißertruppe von vier Franzosen, hatte diese Gasflaschen zu schleppen, hab den Franzosen sofort auf Französisch zugerufen: "Kameraden, ich habe keine Ahnung vom Autogenschweißen, bin von der Widerstandsbewegung." - "Ist gut, ist gut, komm nur!" Und sie haben mich in die Mitte genommen und mir geholfen. [...] In einem Bombentrichter, der unten voll Öl war und worin ein großes Stück Rohr lag, hatten diese Franzosen [...] in dem Rohr einen Geheimsender gebastelt und hatten Verbindung mit der französischen Armee. Sie haben mich sofort ins Vertrauen gezogen, weil sie gesehen haben, dass ich verlässlich war. Man konnte sich auf die Franzosen wirklich verlassen, sie warnten mich vor zwei von etwa 100 Franzosen, vor zweien, aber nicht weil die unzuverlässig sind, sondern weil sie zu viel reden, und das ist gefährlich. Sonst war ausgemacht, da ich Wien kenne und das Gelände, wenn 's zu einem Aufstand kommen kann bei der Befreiung, dann sollte ich die Führung übernehmen. Ich kannte das ganze Gebiet. Das war mein Vorteil in diesem Lager. Es sollte nicht dazu kommen.




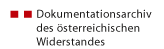







 English
English Termine
Termine Neues
Neues