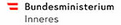Oswalda Tonka, geboren 1923 in Wien, früh mit der politischen Haltung ihrer engagierten kommunistischen Familie konfrontiert, tritt 16-jährig dem Kommunistischen Jugendverband bei. Kaufmännische Angestellte, während ihrer Dienstverpflichtung beteiligt an Sabotageakten in ihrem Betrieb. Im Sommer 1944 Anschluss an die Jugoslawische Befreiungsarmee, im Partisanenverband bis Kriegsende als Funkerin tätig.
Verstorben 1999
Das muss so ungefähr im August, August oder Anfang September 44 gewesen sein. Ich sollte Luftwaffenhelferin werden. Da hab ich gesagt, zur Deutschen Wehrmacht geh ich nicht! Ich hab ja nie die geringste Sympathie für die Faschisten gehabt, aber da war schon innerlich alles aufgestaut - im Mai ist mein Onkel hingerichtet worden -, da war ich schon so voll Hass, das hätte ich einfach nicht fertiggebracht, zur Deutschen Wehrmacht zu gehen.
Zur damaligen Zeit, jetzt muss ich sehr persönlich oder privat werden, hab ich einen jungen Mann gekannt, einen Slowenen, mit dem ich sehr befreundet war, das heißt, wir hätten geheiratet, wenn es möglich gewesen wäre. Ich wusste, dass er Verbindung gehabt hat zu den Partisanen. Mein Freund hat mich gefragt, willst nach Jugoslawien zu den Partisanen? Und ich wollte. Natürlich habe ich mir das viel einfacher und romantischer vorgestellt, als es dann wirklich war.
Jetzt gings einmal darum, das Nötige in die Wege zu leiten. Mein Freund hat die Verbindungen aufgenommen mit seiner Familie, die unten in Slowenien lebte, in einem Dorf, das Besnica heißt, in der Nähe von Kranj. Seine Schwester hat Verbindung zu den Partisanen gehabt, Leute zu ihnen gebracht. Es war vereinbart, dass die mir ein Telegramm schicken, wenn alles klappt. Und wirklich ist das Telegramm aus Besnica bald gekommen: "Mutter schwer erkrankt, komme sofort!" Ich habe keine Mutter mehr gehabt, die war schon seit dem 36er-Jahr tot. Jetzt war das Nächste, was man tun musste, und zwar blitzartig, sich eine Bewilligung holen, dass man mit der Bahn fahren konnte. Ohne Bewilligung konnte man nur bis 150 km fahren, was drüber war, hat man von der Polizei bewilligen lassen müssen. Mit meinem Arbeitsdienstpass, einem Urlaubsschein und mit diesem Telegramm bin ich also auf die Polizei gegangen und hab die Bewilligung gekriegt.
Am Abend des gleichen Tages bin ich schon am Südbahnhof gestanden, in Begleitung meiner beiden Tanten. Vorher war noch ein großes Problem: Es war ja alles, also auch Kleidung, nur auf Bezugsschein zu kriegen, und ich hab ja nichts, fast nichts gehabt. Da haben die Tanten einen billigen Pappendeckelkoffer aufgetrieben. Die eine Tante - sie war bei der Straßenbahn - hat mir ihre Uniformhose, so eine blaue Uniformhose, als Geschenk gegeben. Dem einen Cousin, der in der Zwischenzeit schon zur Wehrmacht eingerückt war, haben wir eine Lederjacke entwendet und ein paar Pullover. So ausgerüstet bin ich zum Südbahnhof gekommen, bin in den Zug eingestiegen und bis Villach gefahren. Das war noch eine normale Reise, wo es öfters Kontrollen gegeben hat und wo ich meine Bewilligung herzeigen musste, sonst ist nichts Aufregendes passiert. In Villach musste ich dann umsteigen, und da war es ungewiss, ob überhaupt ein Zug nach Kranj geht. Erst am nächsten Tag zu Mittag hat es geheißen, es geht ein Zug, der sollte um ca. halb fünf in Kranj ankomen. Von Villach bis Rosenburg gab es schon ununterbrochen Kontrollen, durch die Wehrmacht, durch das Bahnpersonal, logischerweise durch die Grenzpolizei und direkt durch die Gestapo. Na ja, gegen meine Papiere hat man weiters nichts einzuwenden gehabt, aber ich hab ein bisserl Angst gehabt - es war ein sehr warmer Herbst -, dass man meinen Koffer aufmacht, der so warmes Zeug enthielt, was ich für einen kurzen Aufenthalt bei der kranken Mutter um diese Jahreszeit nicht gebraucht hätte. Ich musste vermeiden, dass man den Koffer durchsucht. Da ist im Abteil ein deutscher Soldat gewesen, er war Österreicher, aber bei der Deutschen Wehrmacht eben, mit dem hab ich mich eifrigst unterhalten, und jedesmal, wenn Kontrolle gekommen ist, hab ich mich halt recht zu ihm hingeschmiert, dass die glauben, ich gehör zu ihm. Das haben sie auch geglaubt, jedenfalls sein Gepäck und meines wurden nicht durchsucht. Von Rosenburg an bis hinunter nach Kranj war es dann abenteuerlich, da wurden vor die Lokomotive noch zwei Waggons geschoben, die nur mit Steinen beladen waren, damit der Zug geschützt ist, wenn auf der Strecke Minen gelegt sind durch die Partisanen. Dann ist ununterbrochen gebrüllt worden, dass sich die Reisenden weder am Fenster noch auf der Plattform zeigen dürfen, sonst wird sofort geschossen. Der Zug ist im Schneckentempo vorwärts. Es ist zwar keine Sprengung erfolgt unterwegs, aber trotzdem wars so langsam, dass ich erst um acht Uhr abends in Kranj angekommen bin.
Es hat gegossen wie net gscheit, strömender Regen, und ich da ganz fremd. Zuerst bin ich ein bissl ratlos vor dem Bahnhof gestanden, der Pappendeckelkoffer hat angefangen, sich langsam aufzulösen. Ich wusste, dass nach acht Uhr die Zivilbevölkerung nicht mehr auf die Straße darf, es war Ausgangssperre für die Slowenen. Kranj war deutsche Garnison, voll von deutschem Militär. Ist so ein deutscher Soldat zu mir her und hat gefragt, ob er mir helfen kann. Ich hab sehr schnell überlegen müssen, und dann hab ich gesagt, dass ich Lehrerin bin, dass ich als deutsche Lehrerin hergeschickt worden bin in ein Dorf. Ich hab das Dorf Besnica genannt, obwohl ich net einmal gewusst hab, ob es in diesem Dorf eine Schule gibt. Jetzt suche ich ein Nachtquartier, ein Hotel, sag ich zu ihm. Hotels gibts keine, die sind alle belegt vom Militär, hat er gesagt. Aber er bringt mich zur NSV, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt heißt das, das war eine richtige faschistische Organisation, komm ich also gewissermaßen in die Höhle des Löwen. Aber es blieb mir keine andere Wahl.
Dort war noch der Herr Ortsgruppenleiter, der war in brauner Uniform, und seine Sekretärin. Ich glaube, die haben ein Pantscherl gehabt, weil es war ja lange nach den Dienststunden. Jedenfalls, der Soldat hat mich dort vorgestellt als Lehrerin, und ob man nicht was für mich tun könnte. Der Ortsgruppenleiter war wahnsinnig freundlich, so ein bisserl dürfte ich ihm sogar leid getan haben. Selbstverständlich will er mir helfen, er kann mir kein Bett zur Verfügung stellen, aber hier im Büro hat er mir zwei Fauteuils zusammengestellt, so Lederfauteuils, da kann ich ganz gut draufliegen. Er hat mir noch seinen Mantel dagelassen zum Zudecken. Eigenhändig hat er einen Arm voll Holz geholt, damit ich nachlegen kann. Dann hat er noch gesagt, ich soll halt fürs Winterhilfswerk eine Spende dalassen, dafür, dass er mir das Büro zur Verfügung gestellt hat. Also gut, so habe ich meine erste Nacht verbracht. In der Früh bin ich schon beim Morgengrauen weg, hab ein offenes Haustor gesucht, hab mich dort hineingesetzt, auf meinen Koffer, und hab gewartet, bis es acht Uhr wird, bis das Büro aufmacht, die Krankenkasse, wo die Schwester von meinem Freund gearbeitet hat. Na ja, das war für mich ein Abenteuer, ich war Reisen überhaupt nicht gewohnt, hab nie vorher einen Urlaub erlebt.
Um acht Uhr bin ich auf die Krankenkasse und hab dort das Fräulein Slavka Karlin verlangt. Mein Gott, ist mir dieses Mädchen entgegengekommen, 16 Jahre war sie damals alt, gleich die Augen voll Wasser, weil da die künftige Schwägerin kommt, und die will zu den Partisanen. Für die Leute war das schon eine aufregende Sache. Sie konnte natürlich nicht gleich was unternehmen, sie musste ihren Dienst machen bis Abend. Um sechs Uhr, nach Dienstschluss, haben wir meinen Koffer auf ihr Fahrrad verladen und sind zwei Stunden zu Fuß in ihr Heimatdorf gegangen.
Diese Nacht hab ich bei ihr geschlafen, und am nächsten Morgen hat sie mich in ein anderes Bauernhaus gebracht, das ganz abseits gelegen ist, also nicht direkt im Dorf, zu zwei alten Bauersleuten, die kein Wort Deutsch können haben. Dort soll ich warten, bis alles Weitere geschieht. Ich bin halt den ganzen Tag herumgesessen, die haben für mich extra eine großartige Nudelsuppe gekocht. Aber mir ist halt schon mulmig zumute gewesen, einfach weil ich net reden konnte und weil ich jetzt erst richtig gespürt hab, dass ich in der Fremde bin. Ich hab gedacht, was wird mich erwarten, es wird mich ja niemand verstehn. Nicht Angst, aber ein bissl ein komisches Gefühl hab ich gehabt.
So fürchterlich es am Tag vorher gegossen hat, am nächsten Tag war ein strahlender Sonnentag. Ich hab mich auf eine Wiese gelegt und bin eingeschlafen. Auf einmal hab ich ein Geräusch gehört, bin aufgewacht - das Gefühl ist wirklich net zu schildern - und drei Leute sind vor mir gestanden, zwei Burschen und ein Mädchen. Ein jeder hat eine andere Uniform gehabt, aber alle drei haben Schifferlmützen getragen und den roten Stern oben. Da ist mir im ersten Moment das Herz in die Hose gefallen, und ich hab gedacht, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Von dort bin ich über mehrere Stationen bis nach Cerkno zum Stab der 31. Division gekommen. Das war mitten im deutschbesetzten Gebiet, aber jedes Dorf konnten sie ja nicht besetzen. Die Deutschen waren in Ljubljana und in Kranj, in den größten Orten halt, aber es hat natürlich Dörfer gegeben, wo man sich auch tagsüber zeigen konnte. In Cerkno haben wir in richtigen Häusern gelebt, also im Dorf, und konnten auch tagsüber raus, da waren halt die Deutschen weiter weg. Na ja, wegen meiner mangelnden Sprachkenntnisse hab ich zunächst Wäsche gewaschen für die Kameraden, und beim Kochen hab ich geholfen. Mindestens zweimal in der Woche waren Entlausungen, da hab ich geholfen, die Sachen in den Kessel reintun, dann musste man alles auslüften. Solche Sachen hab ich gemacht, solche Hilfsdienste.
Einmal hat man mich erwischt, wie ich meine Erlebnisse in einen Kalender stenografiert habe. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich das verbergen muss. Sofort musste ich alles vernichten, na gut, ich war ja auch blöd.
Ich erinnere mich, wie wir einmal richtig angetreten und losgezogen sind. Ich hab nicht gewusst wohin, hab immer nur gehört: "Hajka, hajka", das heißt Angriff, Schlacht. Wir mussten uns teilen, eine Gruppe dort und eine dort, und dann wurde das Dorf Zelezniki angegriffen, dort war die Feldgendarmerie. Ich muss ehrlich sagen, ich erzähle das nicht gern: Also unsere Leute sind losgezogen, haben dieses Dorf angegriffen, und die Partisanen haben gesiegt. Die haben den ganzen Posten Feldgendarmerie, zwölf Mann, erledigt, keiner ist übrig geblieben. Dann hat man das Haus, wo die Gendarmerie drinnen war, durchsucht und die ganzen Schriftsachen, sogar die Privatbriefe, angeschaut wegen Informationen. Die privaten Briefe der Leute hat man mir zu lesen gegeben. Es hätte ja was drinnen stehen können, was interessant war. Das musste ich rot anstreichen. Na ja, das war kein leichter Job für mich, weil, trotz allem, so sehr ich die Faschisten gehasst habe, ich habe ja die Gendarmen dort tot liegen sehen. Wenn man dann liest, mein lieber Sohn ... ich mein, es war net angenehm, aber es war halt Krieg, und die Jugoslawen sind ja überfallen worden von den Deutschen.
Für mich war das überhaupt ein Problem: Wir liegen einmal über einem Hohlweg oben im Gebüsch, während unten eine deutsche Patrouille daherkommt. Der Kamerad neben mir drückt mir seine Maschinenpistole in die Hand. Wirklich, es wäre leicht gewesen ... Die sind unten gegangen, ich hab das Gewehr schon in der Hand gehalten und hab es ihm wieder zurückgegeben. Ich konnte einfach nicht schießen, obwohl ich einen unheimlichen Hass gehabt hab. Aber ich hab mir auch gedacht, vielleicht ist es ein Antifaschist. Ich hab es einfach nicht fertiggebracht, auf einen Menschen zu schießen.
Weißt du, wenn ich so gelegen bin in der Nacht und hab die Erlebnisse des Tages vorbeiziehen lassen in Gedanken, hab ich mir gedacht, die sind im Recht, nach allem, was sie durchgemacht haben. Die sind im Recht, dass sie sich wehren, und das haben sie nicht immer mit Glaceehandschuhen gemacht. Aber das Ganze muss man verhindern, hab ich mir gedacht, den Krieg überhaupt, weil der verändert die Menschen so stark. Das Gefühl hab ich manchmal auch von meinen Kameraden gehabt. Die haben kaum von zu Hause geredet, immer nur von Kampf und Sieg. Meine Gedanken sind halt auch viel nach Hause gegangen, was meine Schwester machen wird, was sein wird. Bei meinen Kameraden hab ich das Gefühl gehabt, die denken nicht mehr daran. Da ist mir das ganze Kriegshandwerk zuwider gewesen, obwohl ich wusste, man musste sich zur Wehr setzen, man kann sich nicht einfach erobern, seine Nationalität ausradieren lassen. Dieses ganze Kriegshandwerk muss verhindert werden, weil es die Menschen verändert.
In Cerkno bin ich nicht lange geblieben. Auf einmal heißt es, wir marschieren ab. Anscheinend ist eine endgültige Entscheidung gefallen von irgendeiner übergeordneten Stelle, was mit mir geschehen soll. Es ist eine Ceta zusammengestellt worden, so 30 Mann, das heißt, wir waren 29 Männer und ich die einzige Frau. Über Trebusa, Idrija, Cerknica und Crnomelj sollten wir in das Gebiet zwischen Novo Mesto und Karlovac, nach Dolenjska in das befreite Gebiet. Gebraucht haben wir 21 Nächte für den Marsch dorthin. Das war im Dezember 44, und das war eigentlich das Schlimmste, was ich erlebt habe. Zum Teil ist es über karstiges Gebiet gegangen, wo man sich sehr schwer verbergen konnte. Tagsüber sind wir oft einzeln hinter einem Felsen gelegen oder hinter einer Latsche, und irgendwo ein paar Meter weiter hat man die deutsche Patrouille gesehen. Solange wir noch in den Wäldern waren, war es oft nötig, im Freien zu schlafen. Manchmal ist es gewesen, dass wir bei einem Bauern im Kuhstall oder in einer Holzfällerhütte übernachten konnten. Dann waren wir halt voller Läuse. Also auf meinem Kopf hat es nur so gewurlt, und in der Unterwäsche ist buchstäblich in jeder Masche eine Laus gesessen. Ich hab so entsetzlich gefroren, das vergess ich mein Leben nicht, und wirklich oft zwei, drei bis zu vier Tage lang war kein Bissen zu essen da. Und dieser Karst ist ja auch flusslos. So haben wir halt, wo Schnee gewesen ist, Schnee gegessen, um den Durst zu stillen, oder Gras abgeschleckt, wenn es in der Früh nass war.
Aufregend war, wie wir die Bahnlinie Ljubljana-Triest überschreiten mussten, die war sehr gut überwacht von den Deutschen. Von einem Wachtturm zum anderen konnte man sie nicht nur sehen, ich konnte sie auch hören: "Rosamunde, schenk mir dein Herz heut Nacht", diesen uralten Schlager - damals war er nicht so alt - konnte ich im Radio hören. Und immer ist ein Scheinwerfer gekreist. Entlang der Gleise war Stacheldraht gespannt, und wir mussten einzeln durch den Stacheldraht robben, kriechen und immer schauen, dass man dem Scheinwerferstrahl ausweicht. Erst wenn einer drübergekrochen war, durfte der Nächste losgehen. Wir waren relativ weit verstreut in dem Wäldchen davor, damit, wenn einer hochgeht, nicht die ganze Gruppe dran ist, dass die anderen noch die Möglichkeit haben zu flüchten. Aber wir sind gut rübergekommen, ohne dass wir erwischt worden wären. Ich weiß noch, wie ich warten hab müssen, dass ich drankomm. Ich hab so notwendig aufs Klo müssen und wollt ein bissl tiefer rein in den Wald, aber es war so eisig, sodass der Boden geknirscht hätte. Man musste aber jeden Laut vermeiden. Jedenfalls hat der Politkommissar gesagt, bleib da, und mitten unter den Männern hab ich die Hose runterlassen müssen. Ich muss aber sagen, das hat überhaupt keine Rolle gespielt, als einzige Frau unter Männern zu sein. Bis zum Jahr 43 war ja Liebe zwischen Partisaninnen und Partisanen - das sag ich auch nicht gern - bei Todesstrafe verboten. Ich glaub nicht, dass sie jemals vollstreckt worden ist, aber man hat das damit erklärt, dass es keine Hilfe gegeben hätte, wenn eine Partisanin schwanger gewesen wäre, man hätte sie nicht betreuen können, man hätte sie nicht in ein Lazarett bringen können. Ab 43 war es zwar keine Todesstrafe mehr, aber es wurde immer gesagt, man soll es nach Möglichkeit vermeiden.
Also, es durften die Burschen schon im Dorf mit den Mädchen, aber ansonsten haben sie wirklich strengste Weisung gehabt, die Frauen in Ruhe zu lassen.
Ich war 21 damals, und sehr tapfer bin ich sicher nicht gewesen. Irgendwann auf diesem Marsch haben sie mich Wache stehen lassen. Das haben sie nur einmal versucht! Wir haben in der Nacht in einem Stall geschlafen, und ich bin draußen gestanden. Ich glaub, ich hab alle zehn Minuten Alarm gegeben - wenn ein Hase gerannt ist, bei jedem Geräusch halt. Einmal haben wir wieder in einem Stall übernachtet, und es war ein echter Alarm. Man konnte sich net einmal mehr die Schuhe zuschnüren. Raus, Überfall! Da sind wir gelaufen, ich weiß nicht wie lange, stundenlang, richtig im Kugelhagel, und obwohl ich nie eine Ausbildung gehabt hab, hab ich trotzdem gewusst, wann ich mich niederwerfen muss. Das zeigt auch von meiner Naivität: Im Laufen haben die Kameraden Ballast abgeworfen, alles Unnötige. Der Überfall war ja so schlagartig, dass die Leute die Dinge einzeln getragen haben, dass sie nicht mehr Zeit gehabt haben, sie in den Rucksack zu stopfen. Dann haben sie das weggeworfen, und ich war so blöd und hab es aufgehoben. Ich hab einen Schuh aufgehoben und hab gedacht, der wird ihn doch brauchen. Bis ich dann gemerkt hab, na, das geht net, hab ich alles wieder weggeworfen.
Wir mussten dann durch einen Fluss, das Wasser ist nur bis zum Bauch gegangen, aber das war im Dezember, und im Weiterlaufen, obwohl wir um unser Leben gerannt sind, sind die Hosenbeine vollkommen angefroren an den Beinen. Ich hör noch, wie das geklirrt hat beim Laufen. Dann ist das Schießen schwächer und schwächer geworden, und wir konnten uns in einem Haus sammeln. Das war unwahrscheinlich: Wir waren alle noch außer Atem, und wie wir so gestanden sind, hat einer angefangen zu lachen, und die anderen haben eingestimmt. Das war ein richtig hysterisches Lachen, das nicht aufhören wollte.
In den Jahren 1982 bis 1985 wurden im Rahmen von zwei Forschungsprojekten von den Forscherinnen Karin Berger, Elisabeth Holzinger, Lisbeth N. Trallori und Lotte Podgornik Gespräche mit über 100 Frauen in ganz Österreich über ihren Widerstand und ihre Verfolgung geführt. Eine Auswahl der Erzählungen ist in zwei Büchern veröffentlicht: "Der Himmel ist blau. Kann sein. Frauen im Widerstand. Österreich 1938 - 1945", Promedia Verlag 1985. Aus diesem Buch stammt die Erzählung von Oswalda Tonka. Zwei Jahre später erschien ein Buch mit weiteren Erzählungen: "Ich geb Dir einen Mantel, dass Du ihn noch in Freiheit tragen kannst. Widerstehen im KZ. Österreichische Frauen erzählen", Promedia Verlag 1987.




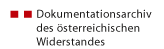






 English
English Termine
Termine Neues
Neues