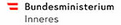Wilhelm Samida, geb. 1910 in Hainfeld, Theologiestudium in Wien, Priesterweihe 1935, bis 1940 Jugendseelsorger in Wiener Neustadt, Herstellung und Verbreitung eines Berichts über die Erstürmung des Erzbischöflichen Palais in Wien am 8. Oktober 1938, zahlreiche antinationalsozialistische Aktivitäten in der Jugendarbeit, Oktober 1939 bis Februar 1940 Gestapohaft in Wiener Neustadt, muss anschließend Wiener Neustadt verlassen, Diözesan-Jugendseelsorger für die Stadt Wien, Juli 1941 "Ostmarkverbot". Medizinstudium in Freiburg im Breisgau, Organisierung einer Studentengruppe, wiederholte Vorladung zur Gestapo, knapp vor Kriegsende neuerliche Verhaftung, durch zufälligen Tieffliegerangriff konnte Flucht gelingen.
Kaplan in St. Johann Nepomuk, Wien-Leopoldstadt, und in Altlerchenfeld, ab 1947 Pfarrer am Laaerberg.
Verstorben 2004.
Wir haben bis zum letzten Augenblick eigentlich gehofft und geglaubt, dass alles gutgeht. Wir waren dann erschüttert von der Schuschnigg-Rede an diesem Abend [11. März 1938]. Ich weiß, wir sind eine Weile zusammengesessen, der [Johann] Leyendecker, der [Karl] Hugel und ich, und diese letzten Worte, die haben uns sehr berührt. Und dann haben wir natürlich gespürt, jetzt wird's ernst, jetzt wird's anders. [...]
Wir haben versucht, weiterhin unsere Gruppen zusammenzuhalten, auf der noch erlaubten, möglichen religiösen Basis, mit Bibelabend und Wallfahrten usw., also rein religiösen Betätigungen. Und das hat eigentlich noch lange Zeit irgendwie funktioniert. Also die wir fest hatten vorher, die haben uns im Wesentlichen die Treue gehalten und haben vielleicht notgedrungen auf der anderen Seite mitgetan, aber die waren mehr oder weniger noch bei uns beheimatet. [...]
1938 waren wir damals noch mit unseren Jugendlichen bei dieser großen Jugendfeier [am 7. Oktober 1938] im Stephansdom. Das hat uns natürlich großen Auftrieb gegeben. Also wir waren alle wie in Ekstase von diesen Ereignissen ergriffen und ganz voll Freude und voll Glück - diese Massen, der Jubel und die Begeisterung der Leute! Aber natürlich ist es dann nachher sehr bald wieder anders geworden.
Ich war damals noch als Kurat an der Dompfarre in Wiener Neustadt und war am Freitagabend ebenfalls mit meinen Jugendlichen zur Feier nach Wien gekommen. Wir hatten schon vieles in den wenigen Monaten seit dem sogenannten "Anschluss" leidvoll erfahren müssen, das Verbot aller Jugendorganisationen, jeder außerkirchlichen Betätigung, Beschlagnahme der Heime, Konfiszierung des gesamten Eigentums, Zwang zum Eintritt in die NS-Organisationen. Das machtvolle Zeugnis der tausenden Jugendlichen im überfüllten Dom von St. Stephan für Christus und die Kirche und die spontane anschließende Kundgebung für den Bischof auf dem Stephansplatz hatten uns damals in einen Zustand der Ekstase versetzt und uns wieder frohen Mut und Hoffnung gegeben.
Am Sonntag, den 9. Oktober hab' ich die 8-Uhr-Messe im Dom gehabt, und nach der Frühmesse, ich weiß noch ganz genau, erfuhr ich durch einen Kirchenbesucher von einem Gerücht, das besagt, dass in Wien am Samstag beim Bischof ganz Schreckliches passiert wäre am Stephansplatz. Ich hab' daraufhin sofort in Wien angerufen, und zwar beim Regens des Priesterseminares Dr. [Walter] Taubert. Ich war nämlich im fünften Seminarsjahr, wo ich eigentlich keine Vorlesung mehr hatte, sein Sekretär und hatte mit ihm ein sehr gutes persönliches Vertrauensverhältnis. Wir waren wirklich fast wie Freunde, kann man sagen. Seine Antwort am Telefon: Ja, er hat auch von den Ereignissen gehört, aber bis jetzt nur gerüchteweise. Die Telefone zum Stephansplatz und zum [Erzbischöflichen] Palais sind gestört. Er will aber noch am Vormittag in die Stadt gehen und sich persönlich informieren. Ich sagte Regens Taubert noch, dass ich gegen Mittag mit dem Motorrad nach Wien komme und ihn besuchen möchte.
Ich war dann gegen 12 Uhr tatsächlich beim Regens Taubert. Er hat sich unterdessen - es war nicht leicht, aber er konnte sich eingehend informieren bei seinem Gang nach St. Stephan und ist von den Ereignissen und von dem Erfahrenen noch zutiefst erschüttert gewesen, wie ich bei ihm war. Zu meiner Meinung, ob man nicht möglichst viele über diese Ereignisse informieren sollte - ich hätte vielleicht gute Möglichkeiten dafür -, sagte mir Regens Taubert, es wäre gut, man sollte es auch wohl, man müsse aber äußerste Vorsicht walten lassen und es dürfe nicht den Eindruck machen, dass es eine offizielle Information des Ordinariates oder des Kardinals sei. Ich sagte dem Regens, dass ich gegen 15 Uhr nochmals vorbeikomme und er mir bis dahin nach seinen Informationen einen detaillierten Bericht schreiben möge. Er versprach es, er wolle aber vorher noch mit jemand drüber reden, also noch Rücksprache halten, ob das günstig ist, ob man das soll usw.
Um 13 Uhr war ich dann zu Mittag bei meinen Eltern. Meine Eltern wohnten seit 1913 im Haus der Buchdruckerei Julius Lichtner in Wien VIII., Strozzigasse 41. [...] Mein Vater war selbst als Schriftsetzer hier lange beschäftigt. Nach dem Tod von Julius Lichtner, er hat viele Kleinschriften für Dr. [Karl] Rudolf [Leiter des Seelsorgeamts der Erzdiözese Wien] und für das Seelsorgeamt gedruckt, hatte seine Tochter, Frau Christl Walla, verheiratete Walla, die Druckerei übernommen. Und da Christl und ich fast gleichaltrig waren und in demselben Haus aufwuchsen, hatten wir ein gutes freundschaftliches Verhältnis zueinander. [...] Ich erzählte ihr von den Ereignissen am Stephansplatz und frug sie, ob sie mir etwa 300 solcher Berichte drucken würde. Sie war sofort dazu bereit und sagte, sie wolle den Text noch heute, bevor noch die Arbeiter am Montag kommen, in einer alten, nicht mehr verwendeten Schrift setzen und auch drucken, den Satz aber dann sofort einschmelzen. Meine Eltern hab' ich nicht drüber informiert, und das war, wie sich später zeigen sollte, auch gut so. [...]
15 Uhr, wieder beim Regens Taubert. Er hatte den Bericht um die Ereignisse am Stephansplatz fertig und war mit meiner Absicht, die südlichen Dekanate zu informieren, einverstanden. Wir versprachen beiderseits, in jedem Fall darüber Stillschweigen zu halten. [...]
Ich bringe den Bericht zu Christl Walla, 18 Uhr, Sonntagabend. Ich bin dann nach Wiener Neustadt gefahren. Und da muss man noch ergänzen, ich bitte Verlässliche aus der bündischen Jugend - Neuland -, morgen Post in die Pfarren des Landdekanates Wiener Neustadt zu bringen. Das war an sich nichts Ungewöhnliches. [...] Zudem waren die Ereignisse von Wien noch kaum bekannt. Also diese Burschen haben damals am Sonntagabend eigentlich noch kaum was davon gewuss, und es war unverfänglich.
Ich selbst schreibe eine Matrize für die Dekanate südlich von Wien mit der Bitte, die beigelegten Berichte über den Überfall auf das Erzbischöfliche Palais in Wien durch Boten den Pfarren des Dekanates zu übermitteln. Das war so, dass es an den Dechanten gegangen ist, und er sollte es dann durch Boten - und scheinbar hat es zum Teil wenigstens funktioniert - in seinen Pfarren weitergeben.
Ein guter Geist warnte mich, die Matrize auf meiner eigenen Schreibmaschine zu schreiben. Bei meiner Verhaftung am 18. Dezember 1939 wurden bei der zweistündigen Durchsuchung meiner Wohnung durch die Gestapo Schreibmaschine und Abziehapparat beschlagnahmt, und im Protokoll des mitternächtlichen [Verhörs] - der hat mich damals um Mitternacht zwei Stunden verhört - sah ich drei Zentimeter große Typenvergrößerungen einzelner Buchstaben, die eben besonders ausgefallen waren. Ham net g'stimmt, Gott sei Dank, denn sonst - das wär' eine Katastrophe gewesen.
So, Montagvormittag. Ich hole die Berichte von Wien und bringe sie am Nachmittag mit dem Motorrad auf einem weiteren Rundkurs in die Dekanatspfarren südlich von Wien, vor allem die weiteren Dekanatspfarren, Gloggnitz und wie die alle geheißen haben. Ich war vor allem bemüht, das Motorrad immer unauffällig und außer Sichtweite abzustellen. Man konnte nicht wissen ... Ich hab' immer versucht, das nur einzuschmeißen - ohne Kontakt, damit ja niemand sagen kann, mit einem Motorrad hat es jemand gemacht. [...]
Dienstag, 11. Oktober. Es gab Pfarren, die mit Glockengeläute die Gläubigen in die Kirche riefen und den Text zur großen Erschütterung verlasen. Nach Gestapo-Berichten wurde der Text mancherorts auch vervielfältigt und weitergegeben. [...]
Unsere Runden haben wir nach wie vor gehalten, in meinem Zimmer, mit Bibellesungen usw. Ich hab' halt immer geschaut, dass ma die zusammenhalten, vor allem diese eine Gruppe, die ich gehabt hab', diese kleinen Buben, mit denen ich vorher in Rom einmal war, und am Schwarzensee haben wir ein Lager g'habt. (1) Das waren Buben von der Hauptschule. Da hab' ich aus den ersten Klassen die Besten halt rausgeholt. [...]
Das erste Verhör war damals nach dieser Weihnachtsfeier, wo ich natürlich sehr ausführlich befragt wurde, wie wir das gemacht haben und wie das Ganze war. Dann über die ganzen Tätigkeiten, die wir aufgezogen haben. Und dann bei meiner Hausdurchsuchung haben sie alle Bildbände, einfach alles auf einen Haufen gehaut und beschlagnahmt; Bildbände und was ma sonst gehabt haben, Bücher, Kinderbücher, alles beschlagnahmt. Das war das eine Mal.
Dann ein zweites Mal überflüssigerweise - ich hab' ein Motorrad gehabt. Ich hab' in dieser Zeit sogar noch Benzinmarken bekommen und eines Tages bin ich eben angezeigt worden. Da hab' ich den [Josef Ernst] Mayer nach Pernitz geführt mit dem Motorrad. Und irgendwie hat sich jemand scheinbar bemüßigt gefühlt, das anzuzeigen, dass ich da Geistliche herumführe mit Benzinmarken, die ich eigentlich für andere Zwecke zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und da war auf der Gestapo ein genaues Verhör, wie und wann und wozu und ob das nötig war, und die Benzinmarken sind dann sofort eingestellt worden. Das war mein zweites Verhör.
Das dritte war dann am 18. Dezember [1939], wo ich ganz brav in der Pfarrkanzlei saß und gearbeitet hab', und auf einmal kommen zwei Herren herein und sagen, sie möchten mich in meiner Wohnung sprechen - die Gestapo. Na, sie haben dann zwei Stunden lang oder mehr als zwei Stunden meine Wohnung auf den Kopf gestellt, also jedes Blattl Papier und jedes Buch herausgerissen und angeschaut, ob net Zetteln drinnen liegen. Und alles, was irgendwie schriftlich war, Notizen und alles, haben sie angeschaut und genau betrachtet und dann alles auf einen großen Haufen mitten ins Zimmer geworfen, die Schreibmaschine dazu, Abziehapparat und Tippbänder. Das hat von zehn bis halb eins gedauert, und dann hat es geheißen: "Ziehen Sie sich an, nehmen Sie sich ein Zahnbürstel mit", und dann hab' ich mit ihnen marschieren müssen quer durch die Stadt zum Gefangenenhaus. [...]
Dann hat es halt begonnen auf die übliche Weise, dass ma ausg'sackelt wird, ob man irgendwas mithat, was verboten oder gefährlich ist, dann kriegt man eine Zelle, und dann ist man halt einmal dort. Und wie geht es weiter? Na, um neun wird das Licht abgedreht, man legt sich nieder. Dann, um elf, geht das Licht wieder an, Schlüsselrasseln, Verhör, Gestapo. Der holt mich ab vom Gefangenenhaus, mit dem Auto wieder zur Gestapo [...] und die war auch nicht weit. Das war so eine Villa, wo die Neunkirchnerstraße eine Biegung macht. Na, und verhört zwei Stunden, das war nach Mitternacht; es ist halt das Übliche, vom Kindergarten angefangen, ganz genau alles ins Nationale aufgenommen worden. [...] Der hat mich verhört, ist herausgekommen, dass mein Vater Schriftsetzer ist, und da ist er natürlich sofort hellhörig geworden und hat sich gedacht, aha, das wär eigentlich eine Möglichkeit, dass man da weiterkommt.
I: Jetzt hat die Gestapo versucht, Verbindungen zu dieser Drucksache von damals herzustellen?
Na ja, natürlich auch. Sie haben das immer noch evident gehabt, immer noch nicht beantwortet gehabt die Frage, wie das ging damals. Nun war aber mein Vater schon lange nicht mehr bei der Druckerei Lichtner, sondern er war im 9. Bezirk in der Sechsschimmelgasse in der Druckerei. Ich hab' dann erfahren, dass sie tatsächlich eines Tages dort in der Druckerei Typen überprüft haben, aber er hat nichts gewusst und es hat niemand was gewusst. [...]
Das war das eine Verhör. Und dann, eine Woche später, war wieder ein nächtliches Verhör, das war die Spezialität vom Herrn [Johann] Schuh damals. [...]
Aber dann war es eigentlich aus. Dann haben sie mich zwei Monate dunsten lassen, und alle Anfragen, die der [Leopold] Uhl [Propst in Wiener Neustadt] und meine Eltern gestellt haben, so beantwortet: "Ja, die Sache geht nach Berlin, und wir müssen abwarten, was da kommt." Na, eigentlich haben sie mir außer meiner Tätigkeit in der Pfarre mit der Jugend nix Wesentliches nachweisen können. Aber leider, das Ganze ist scheinbar aufgeflogen durch einen aus der Gruppe. [...] Ein gewisser Josef Handler [...] der soll angeblich bei der HJ sich bei der Kassa vergriffen haben, und um sich da herauszuhauen und sich wieder zu salvieren, hat er mich dann verraten. So ist mir erzählt worden. Ich kann es nicht nachprüfen. Auf jeden Fall ist er mir nie mehr zugegangen. Nach dem Krieg haben wir einmal ein Treffen gehabt, da war er net dabei, also scheinbar hat er ein schlechtes Gewissen gehabt. [...]
Wie gesagt, nach dem zweiten Verhör war dann lange Zeit Stille. [...] Nach etwas über zwei Monaten war ein Verhör, wo der Schuh mir mitgeteilt hat: "Nach einer Woche werden Sie entlassen." und gleichzeitig dazu die Auflage, sofort von Wiener Neustadt zu verschwinden. [...]
Nach der Entlassung ging Samida nach Wien und war dort unter anderem als Diözesanreferent für die Stadtjugend tätig.
Es war ausgemacht, wir halten eine Sebastian-Feier, wir sagen aber heute noch nicht, wann und wo. Ich hab' erst in der Früh an diesem Tag [20. Jänner 1941] telefonisch ein paar Leuten das durchgegeben, die Sebastian-Feier ist heute abend in der Canisiuskirche um soundso viel Uhr. Der Erfolg: 120 Leute waren da durch Mundpropaganda. Das war ein Versuch, wie rasch wir unsere Leute erreichen können. Leider war auch ein Verrat dabei, denn die Gestapo war auch da.
Es war dann so ... netterweise, muss ich sagen, ist mir vorher von der Gestapo - der [Gestapobeamte] war also schon im Raum drinnen, hat er mich rufen lassen und hat gesagt: "Was haben Sie da vor? Was machen Sie da? Morgen um neun am Morzinplatz." Also, der hat mir das vorher gesagt, dass er da ist. Denn wenn er das nicht gesagt hätte, hätte ich [...] anders geredet und viel mehr geredet ... das wär natürlich dann blöd gewesen.




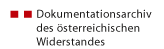







 English
English Termine
Termine Neues
Neues