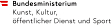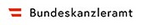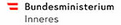Hier finden Sie mit den Objekten des Monats unseren Neuzugang in der Dauerausstellung des DÖW. Monat für Monat werden wir Ihnen hier neue, unbekannte oder womöglich zu wenig beachtete Objekte und deren Geschichte aus unseren Sammlungen präsentieren. Hier erfahren Sie zudem die wichtigsten Hintergründe zu den Objekten und die Motive für deren Auswahl.

Eintrittskarte für die Ausstellung „Niemals vergessen“ (1946)
Signatur: DÖW, M654
Bundeskanzler Leopold Figl und Bürgermeister Theodor Körner waren ebenso ins Wiener Künstlerhaus gekommen wie weitere Vertreter der Bundesregierung und der Alliierten, um am 14. September 1946 die Ausstellung „Niemals vergessen“ zu eröffnen. In den knapp 100 Tagen bis Dezember 1946 besuchten rund 260.000 Personen die Ausstellung, die im Sommer 1947 auch in Linz und Innsbruck gezeigt wurde. Von der sowjetischen Besatzungsmacht bereits im Mai 1945 angeregt, von der Gemeinde Wien mit Zustimmung von SPÖ, ÖVP und KPÖ in Auftrag gegeben und vom Wiener Kulturstadtrat Viktor Matejka vorangetrieben, war die Ausstellung als Teil der didaktischen Aufklärungs- und Erziehungspolitik zur Demokratisierung der österreichischen Bevölkerung gedacht.
Von der Ausstellungsidee bis zur Eröffnung dauerte es 16 Monate. Der lange Zeitraum lässt sich nicht allein durch den Mangel an Ressourcen jeglicher Art erklären, der unmittelbar nach der Befreiung für kurze Zeit existierende antinazistische Konsens aller politischer Gruppierungen hatte rasch zu bröckeln begonnen. Er wurde von der Auseinandersetzung darüber abgelöst, welche Stoßrichtung die Ausstellung nehmen sollte. Politische Rücksichtnahmen und Hindernisse verzögerten die Fertigstellung und brachten das Vorhaben beinahe zum Scheitern. Die Diskussion um die Erweiterung des zeitlichen Rahmens auf die Ära des Austrofaschismus führten zu langwierigen Diskussionen zwischen SPÖ und ÖVP, die eine Debatte um den Begriff „Faschismus“ entfachte und eine Änderung des ursprünglichen Titels „Antifaschistische Ausstellung Niemals vergessen“ verlangte. Der Antifaschismus wurde in den Untertitel verbannt.
Der Fokus der Ausstellungserzählung lag auf den Gräueln und Zerstörungen des Kriegs als Folge des Nationalsozialismus, dem das Narrativ von Widerstand und Verfolgung der politischen Gegner*innen gegenübergestellt wurde – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der alliierten Forderungen in der Moskauer Deklaration vom November 1943 nach dem „Beitrag Österreichs zu seiner Befreiung“. Die Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung waren zunächst nur am Rande Thema, erst im Laufe der sich in die Länge ziehenden Planung fanden die Verfolgung und Vernichtung von Jüd*innen doch noch Aufnahme in die Konzeption. In einem eigenen Ausstellungsraum, gestaltet vom Auschwitz-Überlebenden Heinrich Sussmann, wurde der „Leidensweg der Judenschaft“ – so das im Wiener Stadt- und Landesarchiv aufbewahrte Gestaltungskonzept – bildlich dargestellt und durch einige Objekte – wie Modelle von Gasöfen und Verbrennungskammern – ergänzt. Ohne Kommentar versehen, spiegelte dieses erste Aufzeigen der Verbrechen die Sprachlosigkeit vor dem Unfassbaren wider. Die Involvierung von Österreicher*innen darin blieb ausgespart.

Begleitet wurde die Ausstellung von einem umfangreichen Rahmenprogramm. Zwischen Oktober und Dezember 1946 fanden fast täglich Vorträge im Künstlerhaus und in der Rundfunkstation RAVAG, der Vorgängerin des ORF, statt. Ein als Begleitband zur Ausstellung konzipiertes Gedenkbuch konnte aufgrund der spät eintreffenden Textbeiträge erst fast ein Jahr nach der Ausstellungseröffnung im Sommer 1947 erscheinen. Weder die angedachte Tour der Ausstellung durch alle Bundesländer und ins Ausland noch die Errichtung eines auf der Ausstellung basierenden antifaschistischen Museums in einem Wiener Flakturm wurde realisiert. Das Zeitfenster für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der NS-Herrschaft in der unmittelbaren Nachkriegszeit hatte sich rasch geschlossen. Das Motto „Niemals vergessen“ wurde nur noch von wenigen Antifaschist*innen – vor allem aus den Reihen der Opferverbände der drei Parteien – angesprochen. Das Narrativ der Opferthese, wonach Österreich das erste Opfer der nationalsozialistischen Aggressionspolitik gewesen sei, sollte sich für Jahrzehnte durchsetzen.
Weiterführende Literatur:
- „Niemals vergessen!“ Ein Buch der Anklage, Mahnung und Verpflichtung. Antifaschistische Ausstellung / Herausgeber: Gemeinde Wien, Wien 1946.
- Katalog zur antifaschistischen Ausstellung „Niemals vergessen!“. September–November 1946 Wien, Künstlerhaus, Wien 1946.
- Wenzel, Heidrun-Ulrike, »Vergessen? Niemals!«. Die antifaschistische Ausstellung im Wiener Künstlerhaus 1946, Wien 2018.
- Wenzel, Heidrun-Ulrike, „Niemals vergessen!“. Zur antifaschistischen Ausstellung 1946 im Wiener Künstlerhaus, in: Christian Rapp/Ursula Schwarz (Hg.), „Wider die Macht.“ Die Kunstsammlung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, Salzburg 2022, S. 53-66.
- Die Schau mit dem Hammer. Zur Planung, Ideologie und Gestaltung der antifaschistischen Ausstellung „Niemals vergessen!“, in: Wolfgang Kos: Eigenheim Österreich. Zu Politik, Kultur und Alltag nach 1945, Wien: Sonderzahl 1995 2. Aufl., S. 7–58.
Autorin: Claudia Kuretsidis-Haider, Historikerin
Fotos: Michael Bigus (Objekt), Daniel Shaked (Porträt)




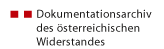





 English
English Termine
Termine Neues
Neues