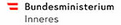Ester Tencer, geb. 1909 als Tochter eines Rabbiners in Galizien, 1914 Übersiedlung nach Wien, Buchhalterin. 1934-1938 illegale Betätigung für eine kommunistische Studentengruppe. Ende Jänner 1939 Belgien. Zugehörigkeit zur "Mädelgruppe" der Kommunistischen Partei, die versuchte, deutsche Soldaten im antinazistischen Sinn zu beeinflussen. März 1943 festgenommen, Jänner 1944 Überstellung in das Sammellager Malines, von dort nach Auschwitz. Ab Anfang 1945 Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück, von dort Mitte April 1945 vom Roten Kreuz nach Schweden evakuiert.
Rückkehr nach Wien. Ehrenamtliche Mitarbeiterin des DÖW.
Verstorben 1990.
Angekommen [in Auschwitz] sind wir in der Nacht, alle Transporte sind in der Nacht angekommen. Ich weiß nur, dass da SS herumgestanden ist, es war ein unheimlicher Eindruck: irgendwo Lichter, und dann ist man - ich weiß nicht, nach welchen Richtungen - einmal dahin, einmal dorthin geführt worden. Die einen sind ins Lager gekommen und andere sind verschwunden. Wir haben damals aber nicht einmal gewusst, ob der ganze Transport oder nur ein Teil hineingekommen ist. Man war nur auf sich selber eingestellt. Die ganze Atmosphäre war so wahnsinnig, so unmenschlich, dass man eigentlich außer sich selber wenig wahrgenommen hat. Wir sind dann ins Lager gekommen. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, sind Frauen. Frauen sind da gestanden, man musste seinen Arm entblößen und sie haben eine Nummer eintätowiert. So sind wir ins Lager gekommen.
Wir sind in die Quarantänebaracke gebracht worden. Da waren Schlafstellen, Kojen, wo man zu viert oder zu fünft hineinkam. Man hat sich mit allen möglichen Fetzen, mit allem, was man eben gehabt hat, zugedeckt. Am nächsten Tag hat es dann geheißen, bevor wir in die Arbeitskolonnen gehen, müssen wir ins Bad, wir und noch andere dazu. Da war ein ganz unheimliches Gefühl im Lager. Man wusste nicht, was los ist. So sind wir halt gegangen und in eine riesige Baracke gekommen, wo wir uns ausziehen mussten. Zu beiden Seiten stand die SS, und dann hieß es: "rechts, links, rechts, links ..." Man hat nicht gewusst, was rechts und was links bedeutet. Die, die Glück gehabt haben, sind ins Lager, ins Arbeitskommando, gekommen, und die anderen sind ins Gas gegangen. Wir haben das damals aber nicht gewusst.
Das Erste, woran ich mich erinnere, als ich bei Tag im Lager war, war, dass ich die Häftlinge gesehen und mir gedacht habe: "Seltsam schauen die aus, die schauen alle tot aus. Die haben so tote Augen, so als ob sie schon gestorben wären." Ich habe eine Frau gefragt, und sie hat gesagt: "Schau, das brennt hier. Du wirst auch bald so ausschauen." Das war das Lagerleben und diese ewige Angst: "Heute kommst du dran, und morgen komme ich dran." Da hat die Menschen schon der Tod gezeichnet.
Ich bin dann in ein Kommando gekommen, zuerst in die Schneiderei. Die politische Organisation im Lager hat immer geschaut, wenn ein neuer Transport hereingekommen ist, ob nicht irgendwelche Genossen oder Kameraden dabei sind. Wenn es die Möglichkeit gegeben hat, hat man sie in irgendwelche Arbeitskommandos hineingegeben, weil man da am meisten geschützt war. Ich war also eine Zeitlang in der Schneiderei und bin dann in ein Kommando zum Steinetragen gekommen. Wieso ich da reingekommen bin, weiß ich nicht. Es war eine sinnlose Arbeit. Man hat Steine von einem Haufen zu einem anderen Haufen transportiert. [...]
Später habe ich dann in dem so genannten "Rotkäppchen-Kommando" gearbeitet. [Die Häftlinge dieses Kommandos trugen rote Kopftücher.] Das war ein Kommando, wo man außerhalb des Lagers war. Man hat den Leuten sämtliche Sachen abgenommen, wenn sie angekommen sind, und unsere Aufgabe war es, alles zu sortieren. Diese Leute haben ja geglaubt, sie kommen in ein Arbeitslager, und so haben sie alles mitgenommen an Geld, Schmuck usw. Die politische Organisation hat uns den Auftrag gegeben, so viel wie möglich ins Lager hineinzubringen, vor allem Geld und Gold, auch Seife, Hemden, Kleider, im Lager hat man ja nichts gehabt. Das Geld und das Gold waren für Genossen bestimmt, die fliehen wollten oder geflüchtet sind.
Am Abend sind wir wieder ins Lager hineingekommen und natürlich zum Teil gefilzt worden. Es wurde nicht jede Einzelne gefilzt, aber man wusste doch, es wird gefilzt. Ich habe noch immer langes Haar gehabt, und da habe ich mir oft Geld oder Gold unter das Haar gesteckt. In diesen gestreiften Häftlingsanzügen haben wir uns versteckte Taschen gemacht, und da haben wir natürlich hineingesteckt, was wir konnten, und auf gut Glück geschaut, dass wir durchkommen. Einmal ist es mir passiert, dass ich gefilzt wurde und man eben bei mir verschiedene Sachen gefunden hat. Da musste ich dann vor dem Block knieen, mit Steinen in den Händen, damit ein jeder sehen konnte, dass man bestraft wird, wenn man dabei erwischt wird. Aber das hat uns trotzdem nicht abgeschreckt, wir haben immer wieder versucht, was wir konnten ins Lager zu bringen, denn es war eine große Hilfe für die Kameraden. [...]
Schließlich war ich Schreiberin auf dem "Krätzeblock". Wegen der Ernährung und dem Schmutz haben sehr viele Leute die Krätze bekommen, und so war da ein eigener Block, damit die anderen nicht angesteckt werden. Diese Kranken mussten nicht mit dem Kommando ausmarschieren, sie sind auf dem Block geblieben und haben auch etwas mehr an Essen bekommen. Wir haben von der politischen Organisation den Auftrag gehabt, dass wir Kameraden, von denen wir nicht wollten, dass sie auf schlechte Kommandos gehen, auf den Krätzeblock nehmen. Jeden Tag war der Appell, und da musste man angeben: Soundso viele sind am Krätzeblock, soundso viele sind wieder in den Arbeitsblock zurückgegangen. Nach diesen Angaben hat man das Essen zugewiesen bekommen.
Ich erinnere mich, dass 1944 sehr viele ungarische Juden hereingekommen sind. Ein kleiner Teil davon ist ins Lager gekommen, die haben natürlich überhaupt nicht gewusst, was das hier ist, und wieder ein kleiner Teil von ihnen ist auf den Krätzeblock gekommen. Nachdem ich Verbindungen gehabt habe, habe ich erfahren, dass am nächsten Tag eine Selektion stattfindet. Das hieß, am nächsten Tag kam ein SS-Arzt und schaute nach, wer arbeitsfähig war und wer nicht, dann ging ein Teil der Leute ins Gas. Das hat geheißen, wenn man uns verständigt hat, es kommt eine Selektion, mussten wir die Leute, die wir auf den Block gebracht hatten, anhalten, dass sie aus dem Block heraus und in Arbeitskommandos kommen. Bei den Kameraden war das natürlich einfach. Ich habe gesagt: "Morgen ist Selektion, du gehst auf den Arbeitsblock, du wirst auf den Arbeitsblock versetzt, du bist bereits gesund!", und damit war es erledigt. Bei den ungarischen Juden, die damals gekommen sind, konnte ich das nicht sagen. Vielleicht hätten sie es mir nicht geglaubt, und meinen Kopf habe ich ja sowieso hingehalten, aber dass ich ihnen sage: "Bitte schön, morgen ist eine Selektion, du musst weggehen!", das war zu riskant. Diese Leute sind an meinem Kittel gehangen und haben gesagt: "Du Antisemitin, du Antisemitin, du willst uns wegbringen!" Wir haben sie direkt an den Haaren hinausgeschleift, sie waren ja gesund und konnten auf die Arbeitsblocks gehen, um zu arbeiten. Wir haben ja gewusst, wenn sie am Krätzeblock bleiben, gehen sie ins Gas. Uns war ja klar, was Selektionen heißen. Die Leute haben geglaubt, wir wollen sie von dem besseren Block, wo sie etwas mehr zu essen bekommen haben und wo es ihnen etwas besser gegangen ist, auf ein Arbeitskommando schicken. [...]
Ich glaube, was man am meisten hervorheben muss, ist diese große Solidarität im Lager. Das war natürlich nicht allgemein, das konnte man ja nicht machen, das war konspirativ. Aber unter den Kameraden bestand wirklich ein derartiger Zusammenhalt, eine derartige Solidarität, dass man mit jedem alles geteilt hat und man auch den moralischen Rückhalt gehabt hat. [...] Ich habe die meisten Kameraden nicht gekannt, aber ich konnte zum Beispiel immer anderes Essen bekommen. Das Lageressen hat hauptsächlich aus Steckrüben bestanden, und die haben einen sehr eigentümlichen Geruch. Ich war sehr geschwächt, wie ich vom Gefängnis gekommen bin, und dieser Geruch hat mich zum Brechen gereizt. Ich habe die ganze Zeit, die ich im Lager war, anderes Essen bekommen, und zwar von Kameraden, die bei der SS im Revier gearbeitet haben. Wahrscheinlich wäre ich sonst zugrunde gegangen, ich hätte die Rüben nicht essen können. Auch in die guten Kommandos, in denen ich war, bin ich auf Grund dieser Verbindungen gekommen. [...]
Mitte Jänner 1945 hat es dann geheißen, das Lager wird "evakuiert". Wir haben gewusst, dass die Rote Armee schon sehr weit vorgestoßen ist und dass sie deswegen das Lager liquidieren. Es hat eine Aussprache gegeben mit den Genossen, den Widerstandskämpfern: Was sollen wir machen? Sollen wir bleiben oder sollen wir mitmarschieren? Da ist es den Kameraden freigestellt worden, ob man gehen will oder nicht. Einige Kameradinnen sind geblieben, der größte Teil ist aber mitmarschiert. Wir sind also losmarschiert, es war Jänner, sehr viel Schnee, und es war kalt. Was wir irgendwie an Essen erwischt haben, haben wir mitgenommen. Wir Kameraden sind, sechs oder sieben in einer Reihe, nebeneinander gegangen. Die SS hat uns an beiden Seiten, mit den Gewehren nach oben, flankiert. Eine Kameradin war arg beisammen, sie hat abgefrorene Füße gehabt und wollte sich unbedingt im Schnee niederlegen. Wir haben genau gewusst, dass sie dann erschossen wird. Wir sind zwischen den Leichen durchgegangen, wer nicht mehr mitgegangen ist und liegen geblieben ist, wurde einfach erschossen. Da haben wir sie getragen, damit sie nicht liegen bleibt, und so ist sie auch durchgekommen bis Ravensbrück.
Man kann später die Wirklichkeit, die wir da durchgemacht haben, kaum noch nachempfinden. Wie man durch den Schnee gestapft ist mit Holzschlapfen, Schuhe haben wir ja keine gehabt, und nur diese gestreiften Häftlingskleider, sonst gar nichts. Wir sind einen ganzen Tag gegangen. Am Abend hat es dann geheißen: "Also wir können nicht weiter." Sie haben uns bei verschiedenen Bauern untergebracht. Ich habe mir mit einer Kameradin überlegt, ob wir nicht verschwinden. Es war Nacht, und es war niemand da, wir hätten also verschwinden können. Aber das Problem war, wir hatten Sträflingsanzüge, sodass man uns sofort erkannt hat, und wir konnten die Sprache nicht. Also haben wir beschlossen, wir gehen weiter mit und sehen, wo wir hinkommen. Während des Transports sind wir fast niemand begegnet, die Bevölkerung hatte anscheinend den Auftrag, nicht rauszukommen und sonst nichts zu tun. Die Leute, die wir getroffen haben, haben uns nichts gegeben und auch sonst nichts gemacht, wir sind einfach durchgegangen. Am zweiten Tag haben wir dann schon den Rückzug der Deutschen gesehen, die Kolonnen aus dem Osten nach Deutschland. Da ist dann ein Teil des Transports auf Lastwagen aufgeladen worden, und wir sind nach Ravensbrück gekommen.




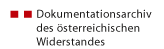







 English
English Termine
Termine Neues
Neues