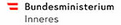Paul Grosz, geb. 1925 in Wien, lebte von Ende 1944 bis zur Befreiung als "U-Boot" versteckt in Wien.
1950 Auswanderung in die USA, 1955 nach Tod des Vaters Rückkehr nach Österreich. 1972 in den Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Wien gewählt, 1987-1998 Präsident, dann Ehrenpräsident der IKG Wien. Vorstands- und Kuratoriumsmitglied des DÖW.
Verstorben 2009.
Wir lebten in einer düsteren, kalten, sehr kleinen Wohnung. Toilette war draußen, es gab kein Wasser. Dort haben wir gelebt, meine Eltern, mein vier Jahre älterer Bruder, ich und die Großmutter, die Mutter meines Vaters. Wir waren ein streng koscherer Haushalt, und das ist auch so geblieben, bis meine Großmutter im Jahre 1935 - damals war ich zehn Jahre alt - gestorben ist. Auch da hat meine Mutter noch weiter koscher gekocht, allerdings nicht mehr so streng orthodox. Ich selbst habe von der Herkunft meiner Mutter, dass sie Nichtjüdin war, natürlich nichts gewusst. [...]
Bis zum Hitler haben wir im 16. Bezirk, das ist ein Arbeiterbezirk, gewohnt. Wir haben mit den nichtjüdischen Kindern im Haus gespielt und eigentlich war die Tatsache, dass wir Juden waren, nur erkennbar, weil wir andere Feiertage hatten und weil wir eben nicht in die Kirche, sondern in den Tempel gegangen sind. Obwohl es natürlich jede Menge Antisemitismus gegeben hat, habe ich als Kind kaum etwas gespürt. Es gab schon Auseinandersetzungen, Rangeleien, aber es war für mich jedenfalls nichts, was von dramatischer Natur gewesen wäre. [...]
1938 war für uns der "Umbruch", wie es damals geheißen hat, der "Anschluss", wie es später geheißen hat, schon eine Zäsur. Ich erinnere mich, dass mein Vater ganz überraschend zeitig nach Hause gekommen ist, in Erwartung der Dinge, die da kommen werden, und ich habe mit ihm, meiner Mutter und wahrscheinlich auch mit meinem Bruder, aber daran erinnere ich mich nicht, die Radiorede, die letzte Ansprache von dem damaligen Bundeskanzler Schuschnigg gehört, mit den bewegenden Schlussworten: "Gott schütze Österreich!" [...]
Wir wohnten, wie ich schon erwähnt habe, in dieser kleinen, hässlichen, dumpfen Wohnung im Parterre, im zweiten Hof. Das hat aber nichts daran geändert, dass wir, schon 14 Tage, nachdem Hitler gekommen ist, unsere Wohnung räumen mussten, die Parteien hatten Unterschriften gesammelt, damit das Haus "judenrein" wird. Ich habe in meinem ganzen Leben niemals mehr so schlecht gewohnt wie dort, wo ich rausgeworfen worden bin, auch während der ganzen Kriegszeit nicht. Aber offensichtlich war es unseren Nachbarn über Nacht nicht mehr möglich, uns das noch zu gönnen, diesen "Palast". [...] Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, dass die übelsten individuellen Ausschreitungen in Österreich stattgefunden haben und dass sie sozusagen beispielgebend für die weitere Entwicklung gewesen sind. [...]
Wir haben sofort versucht, Ausreisemöglichkeiten zu finden. Wir hatten drei Arbeiter [im Kürschnerbetrieb], zwei davon waren Juden, die sind noch in derselben Nacht, in der Hitler einmarschiert ist, illegal bei Aachen über die Grenze nach Belgien gegangen. Sie haben meinen Vater eigentlich aufgefordert mitzugehen, das waren sehr vife Jungs, politisiert. Die haben im 2. Bezirk gewohnt, wo die Situation viel realistischer gesehen worden ist. Mein Vater, der Familie gehabt hat, hat sich das nicht leisten können. Er wollte uns nicht alleine lassen, dazu kam ja noch die Tatsache, dass mein Bruder schwer herzkrank war, und dieser Umstand hat eigentlich unsere Chance, irgendwo aufgenommen zu werden, auf Null reduziert.
1938 wurde in das Pelzgeschäft meines Vaters ein kommissarischer Leiter eingesetzt, der uns zusammen mit den offiziellen Stellen ausgeplündert hat, und so haben wir nicht sehr viele Geldmittel besessen. Wir haben dann versucht - das war dann schon der letzte Versuch -, nach Shanghai zu entkommen, aber das hat mit Geld zu tun gehabt, das wir nicht hatten. [...]
1941 haben wir die ersten Gräuelnachrichten gehört, nämlich Nachrichten über echte Gemetzel, von verlässlichen Menschen, von Geschwistern einer Arbeitskollegin, die sich unter großen Schwierigkeiten und Entbehrungen durchgeschlagen haben, von Lodz, Litzmannstadt. Das war einer der ersten Plätze, wo die Leute ghettoisiert wurden. Sie [unsere Bekannten] haben dann jahrelang als "U-Boote" in Wien gelebt und sind schließlich bei einem Bombenangriff im Gebäude der Kultusgemeinde in der Seitenstettengasse zugrunde gegangen. Von denen haben wir - wir [mein Vater und ich] waren damals in einem Wehrmachtsbetrieb zwangsverpflichtet und erhielten 41 Pfennig pro Stunde, wobei ein Laib Brot 80 Pfennig kostete - von den Ghettos, von den Arbeitslagern und auch schon von Tötungen durch die SS erfahren. Obwohl wir natürlich an den Augenzeugenberichten nicht gezweifelt haben, war es uns noch immer nicht klar, dass das eine universelle Sache war. Wir haben das für eine punktuelle Sache, die sich dort und damals, unter bestimmten Umständen abgespielt hat, gehalten. Viele Leute sind mit diesen Transporten in den Osten mit der vagen Hoffnung gefahren, ein zwar beschwerliches, mit harter Arbeit verbundenes Leben führen zu werden, aber sich dort ansiedeln und leben zu können. Natürlich, später war uns klar, dass wir eigentlich nur mehr Tote auf Abruf waren. Wir haben dann schon verstanden, dass es sich hier um eine unerhörte, bis dahin nicht gekannte Situation handelt. [...]
Die "Nürnberger Gesetze" waren bekannt, aber man hat den vollen Umfang nicht wirklich verstanden. Es war auch so, dass man Schritt für Schritt seiner bürgerlichen Rechte beraubt worden ist, und Hand in Hand ist damit auch der Verlust der Persönlichkeit gegangen, der Eigenständigkeit. Zum Beispiel dieses Zusammenpferchen in Sammelwohnungen war ein Teil des Identitätsverlustes. In dem Maße, in dem der Prozess der zunehmenden Deindividualisierung und damit Dehumanisierung fortgeschritten ist, in demselben Maße wurde man auch unfähiger, individuell zu reagieren. Man hat das gemacht, was alle gemacht haben. Man hat sich angestellt um Visa, einer hat vom anderen erfahren oder gesehen, was zu machen ist, und deswegen kam auch kein Widerstand auf. Die Formen der Deindividualisierung, der Entmenschlichung sind umso krasser geworden, je näher man sozusagen dem Vernichtungsort gekommen ist. Bis schließlich aus den Menschen, die ihre Namen verloren haben, Nummern geworden sind, sie sind zur Sache degradiert worden. Das hat auch den Tätern erlaubt, die Hemmschwellen, die eine jahrtausendalte Zivilisation und das natürliche Gesetz aufgerichtet haben, zu überwinden, und sie haben nicht gemordet, nicht getötet, sie haben schließlich und endlich exterminiert. In einer Welt, in der die Zehn Gebote durch die "Nürnberger Gesetze", die Ethik und die Moral durch die "Neue Ordnung" ersetzt worden sind und zu deren Gott Hitler inthronsiert worden ist, war das möglich.
Die Desolidarisierung mit den Juden ist in der Schule genauso rasch vor sich gegangen wie überall. Für Kinder, mit denen ich noch am Tag vorher Freund gewesen bin, war ich am Tag nachher schon eine negative Erscheinung. Ich erinnere mich, als wir nach etwa drei oder vier Wochen wieder zur Schule gehen konnten - es war ja eine Zeitlang keine Schule -, ist nicht der Klassenvorstand, der Jude war, in die Klasse gekommen, sondern der Englisch- und Turnprofessor, Professor Heinrich. Er hat suppliert, wie man gesagt hat, also er hat eine Ersatzstunde gegeben, und er hat uns in dieser Doppelstunde einen Aufsatz aufgegeben. Ich erinnere mich nicht, ob die Juden auch mitschreiben mussten, wir waren vier Juden in der Klasse. Aber das Thema hieß: "Was ist mir nach dem Umbruch am meisten aufgefallen?" In der nächsten Stunde wurde einer dieser Aufsätze als beispielgebend vorgelesen. Einer der Jungen, der Neffe eines österreichischen Bischofs, hat einen wirklich erbärmlichen, antisemitischen Aufsatz geschrieben, worin der Hauptanteil darin bestand, dass in der Alser Straße, wo er gewohnt hat, viele Geschäfte gesperrt worden sind, weil das jüdische Geschäfte waren, die die "arische" Bevölkerung ausgenützt haben. Es hat mich sehr getroffen. Ich habe nicht wirklich sehr viele Erinnerungen aus der Zeit, [...] aber diese Sache hat mich, ebenso wie der Verlust der Wohnung, schwer getroffen.
Wir sind dann in eine Wohnung im 8. Bezirk eingezogen. Dort haben nur mehr Juden gewohnt, man musste halt zusammenrücken. [...]
Ich habe in dieser neuen Wohnung dann im Juni, im Juni 1938, noch meine Bar-Mizwa gefeiert. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass wir dort eine große Party hatten, eine Kinderparty, die Tische waren zusammengestellt, und alle möglichen Leckereien waren zu haben, und die meisten meiner Freunde, oder eigentlich alle meine Freunde, waren noch da. Es war ein sehr lustiges Ereignis, eigentlich das letzte, woran ich mich noch bildlich erinnern kann.
Unser Geschäft war noch nicht geschlossen, aber natürlich hat der kommissarische Leiter dort langsam die Ware gestohlen. Er hat meinem Vater nur eine gewisse Summe an Geld gegeben, er hat alle Einnahmen an sich gezogen. Nicht nur die Verachtung der Umwelt machte uns zu schaffen, nicht nur die Tatsache, dass wir nicht mehr Gleiche unter Gleichen waren, sondern auch effektive Beeinträchtigungen. Natürlich, dass ich die Schule verlassen musste, hat dazu beigetragen, das Gefühl, dass wir in einer schlechten Situation sind, zu verstärken. Nichts aber hat uns darauf vorbereitet, auch nur zu ahnen, was auf uns und auf andere Menschen noch zukommt. [...]
Wir waren schon am 9. November [1938] zu Mittag, also ehe die Pogrome noch begonnen haben, davon unterichtet oder haben es befürchtet, dass was passieren wird. Ich erinnere mich, dass mein Vater und mein älterer Bruder sich bei einer christlichen Familie versteckt haben, während ich - noch ein Kind - damals bei einer Tante übernachtet habe. Wir sind insgesamt drei Tage von zu Hause weggeblieben. Ich habe dann nur noch die Resultate dieses Pogroms gesehen, nämlich die verbrannten Tempel, die zerstörten, ausgeplünderten Geschäfte, und ich hab natürlich von den Leiden und von den Schrecknissen dieser Nacht erfahren. Es gab unmittelbar nach dem 10. November [1938] - in der Nacht vom 9. auf den 10. November hat sich das abgespielt - Plätze, wo die gefangenen Juden konzentriert worden sind, ehe man sie abgeschoben hat nach Buchenwald und Dachau. Da gab es ein berüchtigtes Gefängnis in der Karajangasse im 20. Bezirk und ein anderes nicht weit von uns, ein ehemaliges Kloster. Es gehörte eine Schule zu diesem Kloster, der Schulunterricht ist dort abgebrochen worden und das Gebäude wurde von der Polizei verwendet, um Juden hereinzupferchen [gemeint Kenyongasse]. Man konnte die Frauen der gefangenen Männer sich dort anstellen sehen. Vielen Juden ist erst damals die Ernsthaftigkeit der Bedrohung bewusst geworden.
1939 wurde meine Schule gesperrt. Ich ging dann in die sogenannte "Jual", in die Schule der Jugendalijah, die mit Zustimmung der Gestapo vorbereitende Kurse, Arbeitskurse für Jugendliche, eingerichtet hat mit der Absicht, sie nach Palästina zu verfrachten.
Noch 1938 hat man den Vater von einem meiner engsten Freunde aus dem Konzentrationslager entlassen, unter der Bedingung, dass er innerhalb einer Woche das Land verlässt. Die Frau und der Mann konnten ausreisen, die eine Tochter, die ältere, ging illegal nach Palästina, der ältere Sohn, mein Freund, ging mit einem Kindertransport nach England, aber das kleine Kind, die vierjährige Sylvia, ist bei uns geblieben. Die Mutter hat ihr Kind bei uns lassen müssen, weil sonst ihre gesamte Familie gefährdet gewesen wäre. So habe ich ganz plötzlich eine Schwester gehabt. Das Kind ist bei uns fast ein dreiviertel Jahr geblieben und ist erst mit dem letzten Kindertransport, 1939, nach England gekommen. Ich erzähl das deswegen, um zu zeigen, dass es sich nicht, wie das so locker gesagt wird, um Menschen gehandelt hat, die ausgewandert sind, die emigriert sind, sondern das waren Menschen, die vertrieben worden sind und die geflüchtet sind, die zu großen Opfern bereit waren. [...]
In der Jugendalijahschule verbrachte ich dann die vielleicht schönsten Jahre meiner Jugend. Während wir, das war eine Ganztagsschule, dort gewesen sind, gab es keinen Stress, nicht die Gefahr, der Juden sonst ausgesetzt waren, und erst nach Kriegsbeginn 1939, als die ersten Transporte in das spätere "Generalgouvernement" geleitet worden sind, haben auch wir Kinder die volle Gewalt, die da angewendet worden ist, zu spüren bekommen. Wir mussten damals, das war ein Teil der Ausbildung der Jugendalijahschule, täglich in den Rothschild-Gärten im 19. Bezirk beziehungsweise in einer Gärtnerei in der Krottenbachstraße unentgeltlich schwere Arbeit leisten, unter dem Vorwand, dass wir dadurch Übung bekommen. Später wurden dann Kinder von uns zur landwirtschaftlichen Arbeit ins Ruhrgebiet geschickt und blieben dort fast ein halbes Jahr.
Zu dieser Zeit haben Kinder mit fünfzehn, sechzehn, siebzehn Jahren schon versucht, mit kleinen illegalen Transporten über Jugoslawien nach Israel zu kommen. Manche sind umgekommen an der Grenze zwischen Deutschland und Jugoslawien, einigen ist es gelungen, bis nach Palästina zu gelangen.
Ich selbst habe eine Ausbildung als Elektriker, als Schlosser und, vom Training meines Vaters her, als Kürschner genossen. Ich bin im Jahre 1940 zur Zwangsarbeit in eine Uniformfabrik eingezogen worden, wo auch mein Vater gearbeitet hat. Wir hatten einen Stundenlohn von 41 Pfennig und Lebensmittelkarten, die ungefähr ein Viertel der normalen Ration, aber unter Ausschluss von Fleisch und Eiweißprodukten, beinhalteten.
Die bedrückende Situation wurde dadurch nicht leichter, dass sich bei uns 1939, 1940 die letzten Möglichkeiten zur Auswanderung verschlossen haben. Es gab nach Kriegsausbruch noch die Möglichkeit, über Portugal nach den USA zu gelangen. Das haben wir angestrebt, es ist uns aber nie gelungen, hauptsächlich weil mein Vater in einem Gebiet der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie geboren worden ist, das später zur Tschechoslowakei gehört hat und deswegen auf Grund der Quotenregelung erst sehr spät im Jahre 1939 drangekommen wäre, eigentlich erst 1940, und zweitens, weil wir nicht genug Geld gehabt haben, und drittens, weil mein Bruder, der vier Jahre älter als ich war, ein sogenanntes "blaues Baby" gewesen ist, was damals nicht operabel war. Ihn haben wir 1940, als wir nach Haus gekommen sind, mit einem schweren Schädeltrauma in der Wohnung vorgefunden. Man hat uns erzählt, dass uniformierte SA-Männer in die Wohnung gekommen sind, angeblich um eine Haussuchung zu machen. Wir wissen nicht, was passiert ist, jedenfalls ist er wenige Tage später in dem damals noch funktionierenden Rothschildspital am Gürtel gestorben.
Ich bin dort [in der Uniformfabrik] geblieben bis Ende 1944, also bis ich untergetaucht bin. [...]
Ich kann nicht wirklich die Zeitläufe abgrenzen. Das ist alles ein zusammenhängendes graues Bild. Es war eine Zeit, in der ich in Lebensgefahr gewesen bin, wenngleich ich das so nicht ununterbrochen empfunden habe. Es gab so viel Routine, auch Hunger und Angst waren Routine. [...] Es gab kein Vertrauen mehr, ich lebte in einer feindlichen Umwelt. [...]
Es gab natürlich noch Verbindungen zu gewissen Leuten von früher, aber das alles war mit Gefahr verbunden, sowohl für die anderen als auch für uns. Am Zentralfriedhof hat eine Familie gelebt, die den Friedhof betreut hat. Ich hab den Namen vergessen, aber ich weiß, einen Sommer lang, es muss im Jahr 1941 gewesen sein, sind wir jeden Sonntag hinausgefahren, und für uns war der Friedhof ein Platz der Erholung, des Sonnenscheins, der freien Natur, unser El Dorado. Dort gab es so viele Tote und so wenige Lebende, das war eine wunderschöne Sache.




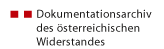






 English
English Termine
Termine Neues
Neues