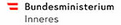Ina Markova: Die NS-Zeit im Bildgedächtnis der Zweiten Republik
Dissertation, Universität Wien, 2016 (Abstract)
Diese Arbeit wurde mit dem Herbert-Steiner-Preis 2016 ausgezeichnet.
Die vorliegende Dissertation untersucht das österreichische Bildgedächtnis der Zweiten Republik in Bezug auf Visualisierungen der NS-Zeit. Ausgehend von geschichtspolitischen Fragestellungen wurde mit Christine Brocks eine "funktionalistische Motivanalyse" unternommen. Dabei wurden die Erinnerungsmedien Geschichtsschulbücher, Ausstellungen, Zeitungen/Zeitschriften und Bildbände untersucht. Aufgrund der spezifischen Ausprägung der österreichischen "Opferthese" erschien es trotz der Fokussierung auf die NS-Zeit unumgänglich, auch die unmittelbare Nachkriegszeit bis zur Unterzeichnung des Staatsvertrags in die Untersuchung mit einzubeziehen. Methodisch wurden politisch-ikonografische und diskursanalytische Überlegungen zu einer "geschichtspolitischen Bilddiskursanalyse" gebündelt, die Bilder wurden in einer Datenbank verwaltet und mittels der Quantitativen Bildtypenanalyse nach Elke Grittmann aufbearbeitet.
Versucht man die Transformationen und Zäsuren des österreichischen Bilderkanons zu skizzieren, so lassen sich folgende Entwicklungen beschreiben: Von April 1945 bis Herbst 1946 kann eine von außen induzierte, aufklärerische Phase der visuellen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, vor allem von Seiten der US-Alliierten, konstatiert werden. Ab 1947 begann anschließend die Phase der Ausbildung prägnanter Gegenbilder zur NS-Zeit. Diese Charakteristika verstärkten sich in den 1950er-Jahren: Die zentralen printmedialen Schlüsselbilder der 1950er-Jahre waren visuelle Repräsentationen des Staatsvertrags, wobei diese Fotografien die NS-Zeit überblendeten. Der zweite zentrale Bilddiskurs dieser Jahre ist jener des Wiederaufbaus. Vor allem im Schulbuch wurde deutlich mit der Strategie der fehlenden Visualisierung operiert. In den 1960er-Jahren differenzierte sich der österreichische Bilderkanon aus. Generell ist eine Rückkehr zur antifaschistischen Auslegung der "Opferthese" zu konstatieren, was sich im Stellenwert des Widerstands, aber auch in der flächendeckenden Visualisierung des "Anschlusses" äußerte: Meist wurden nur jene Bilder als repräsentationsmächtig angesehen, die sich nahtlos in die Repräsentation des "Anschlusses" als scheinbar auch für die Mehrheitsbevölkerung nur leidvolle Erfahrung integrieren ließen. Allerdings lässt sich für die 1960er auch ein zaghaftes Wiederherantasten an den Themenbereich Holocaust konstatieren, wovon wichtige Wanderausstellungen zeugen. Die 1970er sind durch einen Bilderboom gekennzeichnet, was besonders auf die Einrichtung der Dauerausstellungen in Mauthausen, Auschwitz und im DÖW zurückzuführen ist. Auch die TV-Serie Holocaust führte zu einem Anstieg in den Visualisierungen. Vor allem im liberalen Zeitungsspektrum kam es im Umfeld der Berichterstattung über Holocaust zu einer Präformierung des Shoah-Bilddiskurses. Die "Affäre Waldheim" war schließlich der Kulminations- und Wendepunkt von Tradierungskrisen, die sich seit den 1960ern abgezeichnet hatten. ÖsterreicherInnen erschienen erstmals verstärkt als TäterInnen: Die Erosion der "Opferthese" bzw. deren Erweiterung zur MittäterInnenthese fand vor allem auf Ebene der textlichen Kommentierung der Fotografien statt. In den 1990ern war eine größere Bandbreite an Themen prinzipiell ansprechbar und zeigbar. Im Lichte der von Bundeskanzler Vranitzky 1991 skizzierten These von Österreich als "Opfer und Mittäter" wurden Schlüsselbilder neu kontextualisiert und durch andere Bilder oder Kommentierung gerahmt.
Eines der zentralen Themen des 21. Jahrhunderts war anschließend die NS-"Euthanasie", wobei gerade hinsichtlich der Visualisierung dieses Themas Probleme einer angemessenen Repräsentation deutlich wurden. In den neuen Ausstellungen der Gedenkstätte Mauthausen aus 2013 nimmt wiederum die Auseinandersetzung mit Zwangsarbeit einen zentralen Platz ein. Generell zeichnen sich die Bildangebote des 21. Jahrhunderts durch einen reflexiven Zugang zu Fragen der Repräsentation aus. Nachdem in den bisherigen Jahrzehnten das Feld des Zeigbaren kontinuierlich erweitert wurde, sowohl um neue Themen als auch neue Bilder, so wird nun erstmals auch die Frage diskutiert, was man überhaupt zeigen darf.
Ina Markova, Historikerin, derzeit Mitarbeiterin des Projekts "Inbesitznahmen. Das Parlamentsgebäude in den Diktaturen zwischen 1933 und 1945" (Leitung: Bertrand Perz und Verena Pawlowsky), Post-DocTrack-Stipendiatin der ÖAW
<< Herbert-Steiner-Preisträger*innen




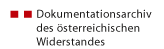





 English
English Termine
Termine Neues
Neues